Alpine Solaranlage Davos Parsenn, Jahresproduktion etwa 10 GWh, grüner Strom für rund 2'400 Haushalte.
2.5.2025
Die Vision, in den Davoser Bergen Solarstrom zu produzieren, wird schon länger verfolgt. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung war der Aufbau einer alpinen Photovoltaik-Versuchsanlage durch die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) im Jahr 2017. Diese Anlage auf der Totalp dient als Testlabor, um den Einfluss der alpinen Bedingungen und unterschiedlicher Modulkonfigurationen auf den Stromertrag zu erforschen.
Für die geplante alpine Solaranlage in Davos fiel die Wahl auf das Parsenngebiet, genauer gesagt auf die Totalp. Dieser Standort liegt auf einer Höhe von rund 2’500 Metern über dem Meeresspiegel. Es handelt sich um den Südhang des Totalphorns im Meierhofer Tälli, ausgerichtet nach Süden.

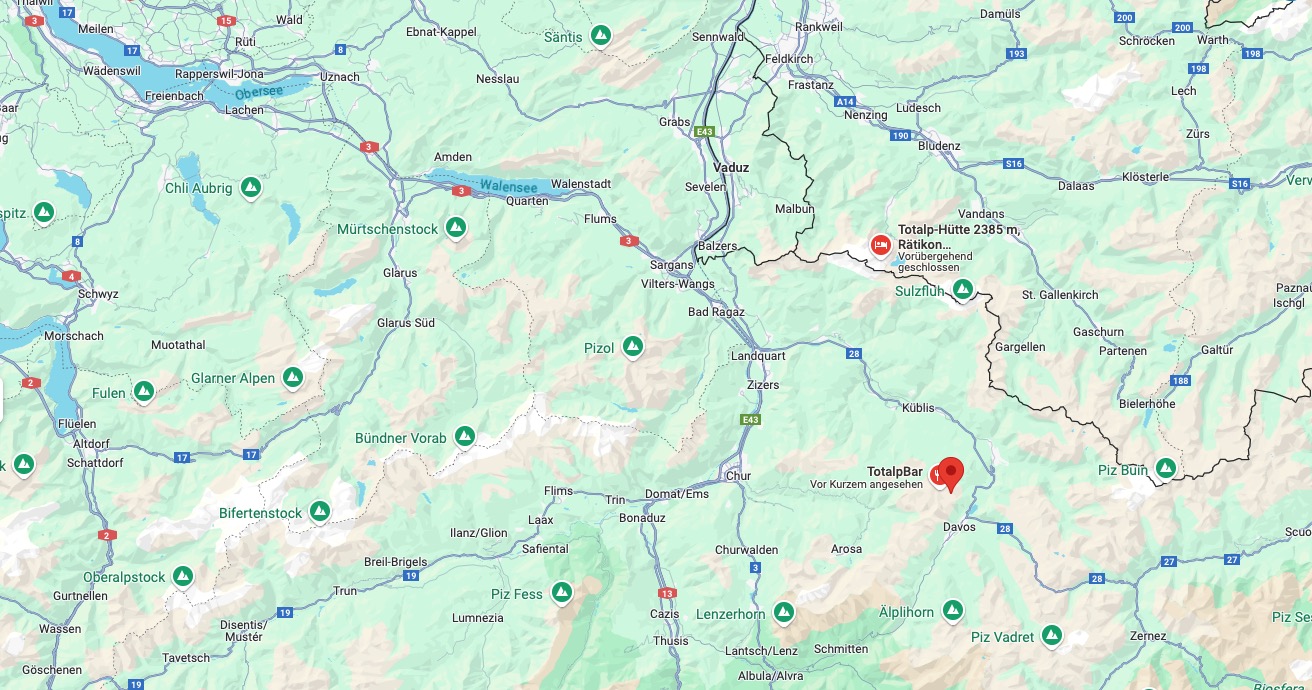
Die geografische Lage in dieser Höhe bringt spezifische klimatische Bedingungen mit sich, die für die Solarstromproduktion vorteilhaft sind, besonders im Winter. Im Vergleich zum Mittelland gibt es in alpinen Höhenlagen deutlich weniger Nebeltage. Dies führt zu mehr direkter Sonneneinstrahlung. Die Intensität der Sonneneinstrahlung ist in grosser Höhe generell höher. Schnee aus der Umgebung reflektiert das Sonnenlicht. Dieser Effekt, bekannt als Albedo-Effekt, ist besonders vorteilhaft für bifaziale Solarmodule, die das Licht von beiden Seiten nutzen können, da sie zusätzliche Strahlung von der schneebedeckten Oberfläche empfangen. Kalte Umgebungstemperaturen wirken sich positiv auf die Leistung und Effizienz von Solarmodulen aus. Messungen zeigten, dass hohe Modulleistungen (> 0.8 W/Wp) in alpinen Höhen, teilweise bedingt durch tiefe Temperaturen, häufig vorkommen. Der alpine Standort auf der Totalp bietet günstige natürliche Bedingungen für die Solarstromproduktion, insbesondere im Winterhalbjahr. Verglichen mit Anlagen im Mittelland profitiert Davos im Winter von mehr Sonnenstunden, höherer Solarstrahlung und weniger Nebel.
Ein weiterer Vorteil des gewählten Standorts auf der Totalp ist die bestehende Infrastruktur. Da sich die Anlage mitten im Skigebiet befindet, ist der Ort dank der vorhandenen Sessellift- und Gondelbahnen gut erschlossen. Dies minimiert Transportverluste des produzierten Stroms durch die Nähe zu bestehenden Anlagen und potenziellen Verbrauchern. Die Planung legt zudem Wert darauf, wertvolles Kultur- und Weideland zu schonen und die Anlage so zu positionieren, dass sie vom Tal aus nicht sichtbar ist, um Beeinträchtigungen für die Bevölkerung auszuschliessen.
Eine zentrale Herausforderung liegt aber im anspruchsvollen alpinen Umfeld selbst. Dazu gehören die exponierte Lage auf rund 2'500 Metern über dem Meeresspiegel, extreme klimatische Bedingungen wie starke Winde (Spitzen über 200 km/h wurden an anderen alpinen Standorten gemessen) und hohe Schneelasten. Schneeansammlungen auf den Modulen können den Stromertrag beeinträchtigen.
Öffentlichkeitsbeteiligung, politische Debatten und gesellschaftliche Akzeptanz.
Die geplante alpine Solaranlage auf der Totalp im Parsenngebiet in Davos ist ein Projekt von erheblicher Tragweite, das nicht nur technische und ökologische Aspekte umfasst, sondern auch auf breite politische und öffentliche Unterstützung angewiesen ist. Ein zentraler Schritt auf dem Weg zur Realisierung war die Zustimmung der Davoser Bevölkerung. Am Wochenende des 17. Dezember 2023 stimmten die Davoser Stimmbürger dem Projekt zum Bau der alpinen Photovoltaikanlage auf der Totalp zu. Das Vorhaben wurde von der Bevölkerung positiv aufgenommen und mit 75% der Stimmbevölkerung wurde das Projekt angenommen.
Dieser positive Volksentscheid folgte auf die Zustimmung des Grossen Landrats, der dem Projekt zuvor bereits mit 15 zu 2 Ja-Stimmen zugestimmt hatte. Diese parlamentarische Debatte war für Anfang November 2023 geplant, nachdem die Davoser Regierung dem Projekt zugestimmt hatte. Die deutliche Zustimmung sowohl im Parlament als auch an der Urne stärkte die positive Resonanz und das Vertrauen in das Projekt. Die Zustimmung der lokalen Bevölkerung und anderer Interessengruppen ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Realisierung von Energieprojekten, insbesondere im sensiblen alpinen Raum. Bei der geplanten alpinen Solaranlage im Davoser Parsenngebiet zeigt sich ein deutliches Bild der gesellschaftlichen Akzeptanz.
Das Projekt nutzt den sogenannten "Solarexpress" des Bundes, der durch vereinfachte Bewilligungsverfahren und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten die Realisierung grosser Anlagen zur Stärkung der winterlichen Stromversorgung beschleunigen soll. Die Gemeinde Davos will von diesem Programm profitieren. Die erleichterte Bewilligungspraxis im Rahmen des Energiegesetzes (EnG) gilt für Anlagen, die bestimmte Kriterien erfüllen, darunter eine Mindestjahresproduktion von 10 GWh und eine Winterstromproduktion von mindestens 500 kWh pro kWp. Das Projekt leistet so einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der einheimischen Stromproduktion und zur Reduzierung der Abhängigkeit von Stromimporten, insbesondere zur Schliessung der Winterstromlücke. Die Gemeinde Davos profitiert als Grundeigentümerin von einer zweiteiligen Entschädigung, bestehend aus einem jährlichen Fixbetrag pro bebaute Hektare und einer variablen Komponente, die bei grossem Erfolg eine beachtliche Summe erreichen kann. Zudem erhält die Gemeinde das Recht, jährlich bis zu 1'000 MWh Strom zu Gestehungskosten plus Abwicklungskosten zu beziehen.
Die Anlage ist ein wichtiger Schritt für die Gemeinde Davos, die sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 eine CO2-neutrale Destination zu werden. Das Elektrizitätswerk Davos (EWD) ist ein Projektpartner und plant, die Anlage in Kooperation mit Swisspower und weiteren lokalen Energieversorgern zu realisieren.
Trotz der breiten Zustimmung gab es auch kritische Stimmen oder Herausforderungen. Ein Kritikpunkt betrifft das betriebswirtschaftliche Risiko, das aufgrund der Abhängigkeit vom künftig herrschenden Strompreis schwierig kalkulierbar sei. Zudem wurde die Sorge geäussert, dass die Baustelle und die Anlagenfläche Wildtiere stören könnten, die dort ansässig sind. Die zeitlichen Vorgaben des "Solarexpress" werden ebenfalls als Herausforderung beurteilt.
Umweltverträglichkeit.
Bei der Planung wird grosser Wert auf eine landschafts- und umweltverträgliche Umsetzung gelegt, die Kultur- und Weideland schont. Die Anlage soll zudem so positioniert werden, dass sie vom Tal aus nicht sichtbar ist, um Reflexionen oder andere Beeinträchtigungen für die Bevölkerung auszuschliessen. Die Anforderungen des Kantons Graubünden und der Umweltverbände werden umgesetzt. Man arbeitet konstruktiv mit dem Kanton im Bewilligungsprozess zusammen, um den Baustart optimal vorzubereiten.
Durch die Integration in die bestehende Bergbahninfrastruktur ist der Ort bereits gut erschlossen. Dies minimiert die Notwendigkeit, neue Zufahrtswege oder umfassende Infrastruktur für den Bau zu schaffen, was den Eingriff in die Natur reduziert. Zudem werden Transportverluste des produzierten Stroms durch die Nähe zu bestehenden Anlagen minimiert, was ebenfalls ein langfristiger Umweltvorteil ist. Die Planungen wurden mit Rücksicht auf diese Flächen in der Skiregion Totalp-Parsenn durchgeführt.
Repower, ein Unternehmen, das ähnliche alpine Solarprojekte plant, betonte, dass es frühzeitig den Dialog mit Umweltschutzorganisationen gesucht habe, um Einsprachen vorzubeugen, was eine gängige Praxis bei solchen Projekten ist und darauf schliessen lässt, dass Umweltthemen aktiv angegangen werden. Umweltschutzorganisationen fordern generell, dass solche Anlagen nur in bereits vorbelasteten Gebieten gebaut werden, was beim gewählten Standort im Skigebiet zutrifft.
Testanlage und Messungen.
Das Potenzial des Standorts wurde durch den mehrjährigen Betrieb einer alpinen Photovoltaik-Versuchsanlage auf der Totalp bestätigt. Diese Anlage, die seit Ende 2017 von der ZHAW Wädenswil in Zusammenarbeit mit EKZ und SLF/EPFL betrieben wird, untersucht die Stromerträge von Solarmodulen unter alpinen Bedingungen. Die Ergebnisse zeigten unter anderem, dass alpine Anlagen, insbesondere mit steil angestellten, bifazialen Modulen, im Winterhalbjahr sehr hohe Erträge erzielen können.

Bei stark geneigten Modulen rutscht der Schnee rasch ab.
Bild: © Copyright EKZ, Medienmitteilung vom 15. Oktober 2024
Ein entscheidender Befund der Versuchsanlage für die Umweltverträglichkeit betrifft das Verhalten von Schnee auf den Modulen: Bei steil angestellten Modulen (mindestens 60 Grad Neigung) sind die Ertragsverluste durch Schneebedeckung gering bis vernachlässigbar. Bei senkrecht montierten Modulen (90 Grad Neigung) bleiben die Verluste sogar unter einem Prozent. Dies bedeutet, dass aufwändige Schneeräumung, die das alpine Umfeld stören könnte, weitgehend vermieden werden kann.
Schutz vor extremen Windbedingungen.
An diesem Standort wurden sehr hohe Windspitzen gemessen, was enorme Lasten auf die PV-Anlage und die Trägerkonstruktion verursacht. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für den Bau, der im Sommer 2025 beginnen soll, werden die Konstruktionen optimiert. Es ist sicherzustellen, dass die endgültige Anlage den extremen Bedingungen standhalten kann. Der Schutz vor extremen Windbedingungen ist eine kritische Komponente bei der Planung und dem Bau der alpinen Solaranlage Davos Parsenn. Durch die Messung von Winddaten an der Versuchsanlage, die Berücksichtigung der Herausforderungen, die extreme Böen verursachen, und die laufende Optimierung sowie die Erprobung neuer Konstruktionen auf der Totalp stellen die Projektpartner sicher, dass die Anlage robust genug ist, um in diesem anspruchsvollen Umfeld zuverlässig Strom zu produzieren.

Schneedruck und Schneekraterbildung.
Bei bifazialen Modulen mit einer Neigung von mindestens 60 Grad machen die durchschnittlichen Ertragsverluste durch Schneebedeckung im Winterhalbjahr weniger als drei Prozent des theoretischen Ertrags aus. Spezifischen Details zu den Herausforderungen von Schneedruck, das heisst die Last der angesammelten Schneedecke auf der Struktur oder Schneekraterbildung, also potenzielle Bildung von Vertiefungen oder Anhäufungen von Schnee rund um die Anlagen, die wiederum Druck auf die Strukturen ausüben oder die Schneeräumung erschweren könnten sind aktuell nicht öffentlich bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass solche Lasten berücksichtigt werden und die Optimierung der Konstruktionen für das "herausfordernde alpine Umfeld" umgesetzt wird.
Bisherige Messresultate.
Die bisherigen Messresultate übertrafen die Ertragsprognosen. Bifaziale Module lieferten über das Jahr gemessen 25-28% Mehrertrag gegenüber monofazialen Modulen. Gegenüber einer durchschnittlichen PV-Anlage in der Schweiz (ca. 1000 kWh/kWp) wurden Jahreserträge von 1690 bis 1837 kWh/kWp erreicht, was einem Mehrertrag von 70 bis 85 Prozent entspricht. Im Winterhalbjahr waren die Erträge bis zu 3.6-mal höher als bei einer Anlage im Mittelland. In den ertragsschwächsten Wintermonaten (November-Januar) erzeugten die 90° geneigten bifazialen Module in Davos bereits eine ähnliche Energiemenge wie die Vergleichsanlage im Mittelland im Hochsommer. Dieser hohe Ertrag fällt insbesondere dann an, wenn die Schweiz üblicherweise Strom aus dem Ausland importiert, was potenziell höhere Strompreise und somit höhere Einnahmen bedeutet.
Die Langzeitmessungen an der ursprünglichen Versuchsanlage werden bis mindestens 2027 fortgesetzt.
Basierend auf diesen positiven Forschungsergebnissen planen das EWD Elektrizitätswerk Davos AG, die Stadtwerke-Allianz Swisspower AG und weitere Partner wie Energie Wasser Bern, IWB und Energie Thun AG nun die Realisierung einer grossen alpinen Photovoltaikanlage auf der Totalp. Aktuell werden die Konstruktionen optimiert und die notwendige Logistik für den Bau vorbereitet. Eine kürzlich installierte neue Testanlage mit zwei Solartischen am geplanten Standort soll zudem wichtige Erkenntnisse für den bevorstehenden Bau der Gesamtanlage liefern. Auch der langfristige Umweltaspekt ist geregelt: Das Energiegesetz schreibt vor, dass Anlagen nach ihrer definitiven Ausserbetriebnahme vollständig zurückgebaut und die ursprüngliche Ausgangslage wiederhergestellt werden muss.
Wirtschaftliche Aspekte.
Die geplante alpine Photovoltaikanlage im Davoser Parsenngebiet ist nicht nur ein wegweisendes ökologisches Projekt, sondern birgt auch bedeutende wirtschaftliche Dimensionen für die beteiligten Partner und die Region. Die Realisierung eines Grossprojekts in dieser anspruchsvollen Umgebung bringt spezifische Kosten und Einnahmen mit sich, die sorgfältig betrachtet werden müssen.
Projektpartner und Ziele.
Hinter dem Vorhaben steht eine Allianz aus dem EWD Elektrizitätswerk Davos AG, der Stadtwerke-Allianz Swisspower AG sowie weiteren unterstützenden Energieversorgern wie Energie Wasser Bern, Energie Thun AG und der Basler Energieversorgerin IWB. Auch die Gemeinde Davos ist als Grundeigentümerin und Partnerin massgeblich beteiligt. Das zentrale Ziel ist, die einheimische Stromproduktion zu steigern, die Unabhängigkeit von Stromimporten zu erhöhen und die in der Schweiz, insbesondere im Winter, bestehende Diskrepanz zwischen Stromproduktion und -verbrauch zu verringern. Gleichzeitig leistet das Projekt einen Beitrag zum Ziel der Gemeinde Davos, bis 2030 eine CO2-neutrale Destination zu werden.
Erwartete Leistung und Nutzen.
Die Anlage soll auf der Totalp im Parsenngebiet, auf rund 2'500 Metern über Meer, entstehen. Mit etwa 17'000 PV-Modulen wird eine jährliche Produktion von mindestens 10 Gigawattstunden (GWh) angestrebt. Dies wird den Strombedarf von rund 2'400 Haushalte decken können.
Für die Gemeinde Davos als Grundeigentümerin ist eine zweiteilige Entschädigung vorgesehen. Diese besteht aus einem jährlichen Fixbetrag von 2'000 Franken pro bebaute Hektare, was insgesamt mindestens 28'000 Franken pro Jahr ergibt. Hinzu kommt eine variable Komponente, die vom wirtschaftlichen Erfolg der Anlage abhängt und bei grossem Erfolg bis zu 250'000 Franken pro Jahr oder langfristig sogar darüber hinaus betragen kann. Zudem hat die Gemeinde das Recht, jährlich bis zu 1'000 MWh Strom zu Gestehungskosten plus 10% Abwicklungskosten zu beziehen.
Auch ein wirtschaftlicher Vorteil des gewählten Standorts ist die bestehende Bergbahninfrastruktur, die bereits eine gute Erschliessung bietet und für Transport und Logistik genutzt werden kann, was potenziell Kosten spart. Auch die Nähe der Anlage zu Verbrauchern wie den Bergbahnen selbst kann Transportverluste minimieren.
Das Projekt profitiert vom sogenannten "Solarexpress" (Art. 71a EnG) des Bundes, der erleichterte Bewilligungsverfahren und zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten vorsieht. Um die besondere Einmalvergütung von bis zu 60% der Investitionskosten gemäss Solarexpress zu erhalten, muss bis zum 31. Dezember 2025 mindestens 10% der Produktionskapazität ans Stromnetz angeschlossen sein. Die Projektpartner arbeiten intensiv daran, diesen ehrgeizigen Zeitrahmen einzuhalten. Doch sind auch die Kosten für den vollständigen Rückbau der Anlage am Ende ihrer Lebensdauer einzukalkulieren, wie vom Energiegesetz vorgeschrieben.
Die hochalpine Umgebung auf 2'500 m.ü.M. bietet ideale Voraussetzungen für hohe Stromerträge, insbesondere im Winter. Faktoren wie eine hohe Solarstrahlung, wenige Nebeltage, tiefe Temperaturen und vor allem die Reflexion des Sonnenlichts am Schnee führen zu deutlich höheren Wintererträgen als im Mittelland.
Zugänglichkeit des Standorts.
Der ausgewählte Standort auf der Totalp liegt im Davoser Parsenngebiet. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ortes ist, dass er durch die bereits vorhandenen Sesselliftanlagen und Gondelbahnen bestens erschlossen ist. Diese bestehende Bergbahninfrastruktur bedeutet, dass der Standort nicht neu erschlossen werden muss.
Die Planungen für die Solaranlage legen grossen Wert auf eine nahtlose Integration in diese bestehende Bergbahninfrastruktur. Die Nähe zu dieser Infrastruktur und potenziellen Verbrauchern wie den Bergbahnen selbst trägt auch dazu bei, Transportverluste des erzeugten Stroms zu minimieren.
Aktuell laufen die Vorbereitungen für die für den Bau notwendige Logistik im alpinen Umfeld. Ziel der Projektpartner ist es, den Bauprozess effizient und zielgerichtet anzustossen und die Belastung für die Umgebung dabei minimal zu halten. Die Nutzung der bestehenden Erschliessung durch die Bergbahnen dürfte hierfür eine wesentliche Grundlage bieten.
Berücksichtigung des Umweltschutzes beim Bau.
Die Planung wurde mit Rücksicht auf wertvolles Kultur- und Weideland in der Skiregion durchgeführt. Es wird hervorgehoben, dass kein wertvolles Kultur- und Weideland beansprucht werden muss. Der Bauprozess soll effizient und zielgerichtet abgewickelt werden und die Belastung für die Umgebung soll dabei minimal gehalten werden. Die spätere Anlagenfläche soll die dort ansässigen Wildtiere nicht stören oder die Lebensbedingungen von Flora und Fauna beeinträchtigen. Neueste Studien zeigen, dass eine alpine Solaranlage die Biodiversität sogar noch erhöhen kann.
Einsatz nachhaltiger Baumethoden.
Um für den bevorstehenden Bau der Gesamtanlage wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, wurde am geplanten Standort eine Testanlage installiert. Die Testanlage dient dazu, die Konstruktionen unter realen alpinen Bedingungen zu erproben und zu optimieren. Es gibt bereits verschiedene Ansätze für alpine Trägerkonstruktionen mit Seil- oder Tischsystemen, die auf Materialeinsparung und geringere Berührungspunkte mit dem Boden abzielen. Die laufende Optimierung der Konstruktionen für Parsenn Solar an der Testanlage weist darauf hin, dass hier nach den geeignetsten und umweltfreundlichsten Lösungen für das spezifische Gelände gesucht wird.
Genehmigungsprozess und Bau.
Der Weg zur Baubewilligung ist bei alpinen
Grossprojekten komplex und erfordert die Zustimmung verschiedener Ebenen. Ein
entscheidender Schritt wurde im Dezember 2023 getan, als die Stimmbevölkerung
von Davos dem Bauvorhaben mit einem klaren Ja (75%) zustimmte. Zuvor hatte
bereits der Grosse Landrat dem Projekt mit grosser Mehrheit zugestimmt (15 zu 2
Ja-Stimmen). Diese breite lokale Zustimmung war ein wichtiger Schub für das
Projekt. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Photovoltaik-Grossanlagen
liegt bei den Kantonen. Die kantonale Baubewilligung des Kantons Graubünden wurde
bis Ende des Jahres 2024 erwartet. Das Projekt stand im November 2024 kurz vor
dem Erhalt dieser Bewilligung, nachdem die Davoser Stimmbevölkerung im Dezember
2023 positiv entschieden hatte. Ein wesentlicher Teil des Prozesses ist die
Bearbeitung der Rückmeldungen vonseiten der kantonalen Verwaltung zur
beantragten Baubewilligung
Eine neuere Meldung vom März 2025 zeigt eine konkrete Schwierigkeit: Die Baubewilligung lag zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor, und einer der Projektpartner hat sich zurückgezogen. Solche Entwicklungen können den Projektfortschritt und die wirtschaftliche Grundlage beeinflussen. Die Projektpartner arbeiten jedoch konstruktiv mit dem Kanton zusammen, um die Bewilligung zu erhalten. Nach Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung folgt der finale Investitionsentscheid der Partnerunternehmen, bevor die Realisierung offiziell beauftragt werden kann.
Bauphasen.
Die ersten Bauarbeiten sind für Sommer 2025 geplant. Ein wichtiges Ziel ist es, gemäss den Vorgaben des "Solarexpress", mindestens 10 Prozent der Gesamtanlage bis Ende 2025 ans Netz anzuschliessen. Obwohl die Realisierung von Herausforderungen wie der Einhaltung des straffen Zeitplans und der hohen Investitionskosten geprägt ist, sind die Partner zuversichtlich, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Die Vorbereitungen auf den Baubeginn sind für Sommer 2025 ausgerichtet und aktuell werden die Konstruktionen optimiert und die für den Bau notwendige Logistik vorbereitet.
Integration in das lokale Energienetz.
Als Teil des Skigebiets verfügt die Totalp bereits über eine bestehende Bergbahninfrastruktur mit Sessellift- und Gondelanlagen. Es ist eine nahtlose Integration der Solaranlage in diese vorhandene Infrastruktur geplant. Dies reduziert den Bedarf an umfangreichen neuen Erschliessungen und hilft, den Eingriff in die Landschaft zu minimieren.
Direkte Einspeisung ins lokale Netz.
Der in der alpinen Versuchsanlage auf der Totalp erzeugte Strom wird bereits seit 2017 ins Netz der Elektrizitätswerke Davos (EWD) eingespeist. Das EWD Elektrizitätswerk Davos AG ist auch ein Projektpartner bei der geplanten Grossanlage. Dies gewährleistet eine direkte Anbindung an das lokale Stromnetz. Die geplante Grossanlage zielt darauf ab, die einheimische Stromproduktion zu stärken. Mit einer geplanten jährlichen Produktion von etwa 10 Gigawattstunden (GWh) wird die Anlage künftig einen signifikanten Beitrag zur Stromversorgung der Region leisten. Dies soll zu mehr Unabhängigkeit von Stromimporten führen, insbesondere im Winterhalbjahr, wenn die Schweiz traditionell Strom importiert.
Neben der generellen Einspeisung ins lokale Netz und der Stärkung der regionalen Versorgung erhält die Gemeinde Davos als Grundeigentümerin auch das Recht, Strom von der Anlage im Umfang von maximal 1'000 MWh pro Jahr zu einem Bezugspreis basierend auf den Gestehungskosten zuzüglich eines Aufschlags zu beziehen. Dies stellt eine sehr direkte Form der lokalen Integration und Nutzung des erzeugten Stroms dar.
Technische Daten.
- Standort: Die Anlage ist im Skigebiet Parsenn, am Südhang des Totalphorns im Meierhofer Tälli geplant.
- Höhe: Der Standort liegt auf 2'500 m.ü.M.
- Ausrichtung: Die Versuchsanlage ist nach Süden ausgerichtet.
- Modultyp: bifaziale Module.
- Anstellwinkel der Module: steile Winkel (>60 Grad).
- Integration: landschaftsschonend in die bestehende Bergbahninfrastruktur.
- Betriebsdauer (Anlage): Betriebszeit von mindestens 60 Jahren, Option für Verlängerung um weitere 30 Jahre.
- Lebensdauer (Module): Die PV-Module müssen nach rund 25-30 Jahren ersetzt werden.
- Rückbaupflicht: Bei endgültiger Ausserbetriebnahme muss die Anlage gemäss Energiegesetz vollständig zurückgebaut und die Ausgangslage wiederhergestellt werden.
- Geplante Jahresproduktion: etwa 10 Gigawattstunden (GWh).
- Haushalte-Versorgung: Strombedarf von rund 2'400 Haushalten.
- Anzahl Module: etwa 17'000 PV-Module.
Investoren und Projektpartner der alpinen Solaranlage Davos Parsenn.
Das Projekt erfährt zudem Unterstützung durch die ZHAW mit Forschungsergebnissen, wobei die ZHAW primär Forschungsarbeit leistet und eine Versuchsanlage betreibt. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF), EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) und Zenna AG unterstützen ebenfalls das "Alpenstrom"-Projekt und die Forschungsanlage. EKZ war von Anfang an (seit 2017) Partner beim Betrieb der Versuchsanlage.
Die Anlage soll von der EWD Elektrizitätswerk Davos AG realisiert werden. Dies geschieht in Kooperation mit Swisspower AG. Swisspower ist eine Allianz von Schweizer Stadtwerken. An der Planung und beabsichtigten Umsetzung beteiligen sich nebst EWD und Swisspower weitere Energieversorger, die auch Partner der Swisspower-Allianz sind, wie: Energie Wasser Bern (ewb), die Basler Energieversorgerin IWB (Industrielle Werke Basel) und Energie Thun AG.

Bild Visualisierung © Copyright Gemeinde Davos.
Volksabstimmung "Alpine Photovoltaikanlage Totalp/Parsenn"
Die Gemeinde Davos ist als Grundeigentümerin beteiligt und stimmte dem Projekt zu. Sie ist auch an der Planung beteiligt. Der finale Investitionsentscheid der Partnerunternehmen soll nach Erhalt der Baubewilligung getroffen werden
Wer sind die Stromkunden?
Insbesondere soll die Davoser Bevölkerung zukünftig mit Strom aus der PV-Anlage Parsenn versorgt werden. Die Gemeinde Davos hat als Grundeigentümerin das Recht, Strom von der alpinen Photovoltaikanlage im Umfang von maximal 1'000 MWh pro Jahr zu beziehen. Der Bezugspreis setzt sich aus den Gestehungskosten plus einem Aufschlag zusammen. Der erzeugte Strom wird generell ins Netz der Elektrizitätswerke Davos (EWD) eingespeist (basierend auf der Versuchsanlage, was auf die geplante Anlage übertragbar ist). Dies bedeutet, dass der Strom in den allgemeinen lokalen Versorgungsbereich gelangt.
Auf einer übergeordneten Ebene trägt die Anlage zur einheimischen Stromproduktion der Schweiz bei, hilft, die Abhängigkeit von Stromimporten zu reduzieren und ist ein wichtiger Beitrag zur Schliessung der winterlichen Stromlücke. Somit profitiert das gesamte Schweizer Stromnetz und seine Verbraucher von der zusätzlichen Winterstromproduktion.
Übersicht alpine Solaranlagen Schweiz.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Mit herzlichem Dank für das Bildmaterial:
Testanlage, Bild: © Copyright EKZ,
Medienmitteilung vom 15. Oktober 2024
Visualisierung © Copyright Gemeinde Davos.
Volksabstimmung "Alpine Photovoltaikanlage Totalp/Parsenn"