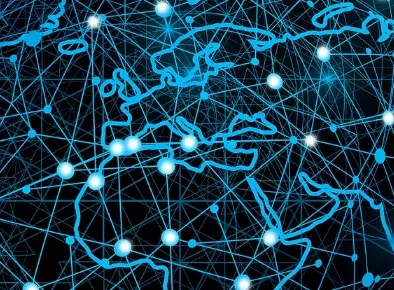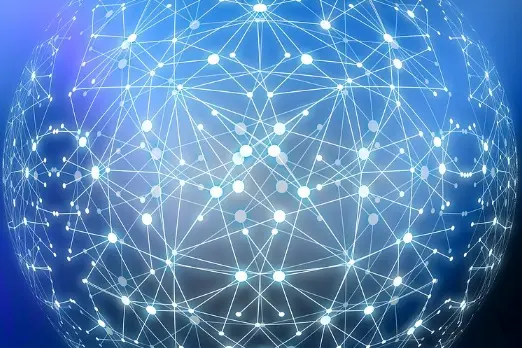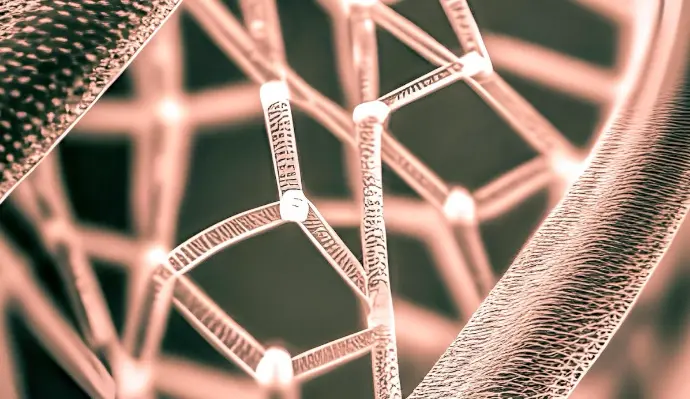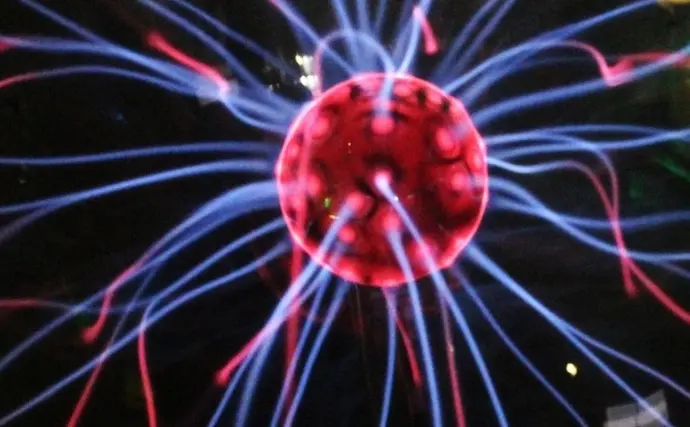COP30 Klimagerechtigkeit, 1% der Menschheit emittiert mehr Kohlendioxid als die ärmsten 66%.
15.11.2025
Bericht: Globale Klimagerechtigkeit, Emissionsdisparität und juristische Verantwortung.
Dieser detaillierte Bericht untersucht die Konzepte der Klimagerechtigkeit, die extreme Disparität bei den globalen Treibhausgasemissionen und die rechtlichen Herausforderungen bei der Zuweisung von Verantwortung, basierend auf den bereitgestellten Quellen.
1. Grundlagen der Klimagerechtigkeit.
Klimagerechtigkeit verbindet zwei zunächst unabhängige Konzepte: Klima und Gerechtigkeit:
Klima ist ein naturwissenschaftliches Thema, das der Klimaforschung entstammt und Bereiche wie Meteorologie, Physik und Geophysik umfasst. Es wird definiert als das über 30 Jahre gemittelte Wetter, eine Erscheinung der Atmosphäre im Zusammenhang mit dem gesamten Erdsystem. Naturwissenschaften beschäftigen sich mit Messwerten.
Gerechtigkeit ist ein Bewertungsbegriff, der nicht aus den Naturwissenschaften, sondern aus der Ethik stammt. Es ist ein Wert, nach dem wir leben möchten, indem die Lasten möglichst gerecht verteilt sind.
Da das Klima ein globales Phänomen darstellt, muss auch die Gerechtigkeitsfrage global betrachtet werden. Die zentrale Ungerechtigkeit besteht darin, dass die Folgen der Treibhausgasemissionen – die hauptsächlich in den reichsten Ländern der Welt entstehen – vorwiegend die ärmsten Menschen auf dem Globus treffen.

2. Disparität der Emissionen und ihre Folgen.
Es gibt eine extreme globale Klimaungerechtigkeit, bei der eine kleine Gruppe von Superreichen einen unverhältnismäßig großen Anteil der Emissionen verursacht:
2.1 Konzentration der Emissionen.
- Das reichste 1% der Menschheit emittiert mehr Kohlendioxid als die ärmsten 66%.
- Eine Oxfam-Studie von 2019, die größte zum Thema globale Klimaungerechtigkeit, zeigte auf, dass die 77 Millionen reichsten Menschen der Welt 16% der Treibhausgasemissionen verursachen.
- Die Emissionen pro Kopf, die von den reichsten Menschen verursacht werden, sind unvorstellbar hoch.
- Die Emissionen der reichsten 1% heben die CO2-Einsparungen, die durch fast 1 Million Onshore-Windräder erzielt werden, wieder auf.
- Jemand aus den unteren 99% der Weltbevölkerung bräuchte 1.500 Jahre, um so viel Kohlendioxid freizusetzen, wie die reichsten Milliardäre innerhalb eines Jahres.
- Die reichsten 0,1% mit ihren Superjachten, Privatflugzeugen, Weltraumtourismus und Bunkern verursachen Emissionen, die 77-mal höher sind als das obere Limit, das notwendig wäre, um die Klimakrise bei 1,5°C zu stoppen.
2.2 Ethische und mortalitätsbezogene Konsequenzen.
Die Emissionen der Superreichen, die durch Statussymbole wie Immobilien, Schiffe und Flugzeuge entstehen, produzieren an Orten, an denen besonders viele arme Menschen leben, ein großes Unmenge an Leid. Diese Situation erfordert dringend eine ethische Diskussion.
Eine Umweltbehörde in den USA hat eine Mortalitätsformel entwickelt (226 überschüssige Tote pro 1 Million Tonnen CO2). Nach dieser Rechnung wären die Emissionen des reichsten 1% für 1,3 Millionen Tote in den nächsten Jahrzehnten verantwortlich.
Die Opfer sind hauptsächlich Menschen in den ärmsten Gesellschaften: Die UN stellt fest, dass 91% der Toten durch Extremwetter in Entwicklungsländern geschehen.
3. Historische Verantwortung und die Rolle Deutschlands.
Die Diskussion um Klimagerechtigkeit und Verantwortung muss über die aktuellen Emissionen hinausgehen und die historische Betrachtung einbeziehen.
3.1 Die Bedeutung der kumulierten Emissionen.
Das Argument der deutschen Bundesregierung, dass Deutschland nur ungefähr 2% des aktuellen CO2-Emissionsproblems ausmacht und damit nationale Maßnahmen keine so große Rolle spielen, ist irreführend. Dieses Argument könnte im Übrigen auch dazu verwendet werden, das Zahlen von Steuern einzustellen.
Das Kohlendioxid-Molekül bleibt sehr lange in der Atmosphäre. Nicht die aktuellen, sondern die angesammelten Mengen seit der Industrialisierung sind entscheidend.
Es besteht ein klarer, direkter Zusammenhang zwischen der kumulierten Kohlendioxidmenge in der Atmosphäre und dem Temperaturanstieg (globale Mitteltemperatur).
3.2 Deutschlands historische Rolle.
Deutschland gehört zu den Verantwortlichen auf diesem Planeten für die große angesammelte Menge an CO2. Dies liegt unter anderem daran, dass Deutschland dank mehrerer Wirtschaftswunder seit Jahrzehnten zu den reichsten Ländern der Welt gehört.
In der historischen Betrachtung der kumulierten CO2-Menge belegt Deutschland den vierten Platz weltweit, nur hinter den Vereinigten Staaten, China und Russland.
Deutschland hat seine Emissionen auch exportiert, beispielsweise durch den Verkauf von Maschinen und Verbrennungsmotoren, die Emissionen anderswo produzierten, was auf das lange währende Dasein als Exportweltmeister zurückzuführen ist. Deutschland trägt somit eine erhebliche Verantwortung für die globale Klimagerechtigkeit.
4. Juristische Wege zur Klimagerechtigkeit: Der Fall Lliuya gegen RWE.
Da Gerechtigkeitsfragen immer auch Verantwortungsfragen sind, stellt sich die Frage, inwieweit Unternehmen, die globale Gewinne erzielen, auch eine globale Verantwortung für Schäden tragen.
4.1 Die Klage und ihre Grundlage.
Der Kläger: Saúl Lliuya, ein peruanischer Bauer, klagte gegen den deutschen Konzern RWE.
Die Situation: Lliuya lebt nahe eines Gletschersees in Peru, der durch schmelzende Gletscher (verursacht durch die Klimakrise) wächst und sein Haus zu fluten droht.
Die Forderung: Lliuya verlangte, dass RWE sich anteilig an den Kosten für die Errichtung eines Schutzwalls beteiligt. Der Anteil sollte den Emissionen entsprechen, die RWE seit der Industrialisierung ausgestoßen hat. Konkret wurden 13.000 € gefordert.
Zuständigkeit: Die Klage wurde vor einem deutschen Gericht (dem Oberlandesgericht, OLG) eingereicht, da RWE als einer der größten CO2-Emittenten weltweit seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland, hat.
Rechtsgrundlage: Die Klägerseite stützte sich auf Paragraph 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), den sogenannten Nachbarschaftsparagraphen, der eigentlich für typische Nachbarschaftsstreitigkeiten (z.B. um Bäume oder Hecken) gedacht ist. Das OLG wandte diesen Paragraphen auf ein globales Nachbarschaftsverhältnis an, was eine bemerkenswerte Rechtsentwicklung darstellt.
4.2 Urteil und juristische Bedeutung.
Ausgang des Verfahrens: Die Klage wurde am Ende abgewiesen.
Grund der Abweisung: Sie scheiterte an der Beweisaufnahme (Tatsachenfeststellung). Ein Gutachten ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Wasser der Gletscherlagune Lliuyas Haus in den nächsten Jahren erreicht und beschädigt, bei weniger als 1% lag, was für eine Haftung von RWE nicht ausreichte.
Der Erfolg: Trotz der Abweisung wird das Verfahren in Klimaschutzkreisen als Erfolg gefeiert. Der springende Punkt ist, dass das Gericht den Anspruch des Klägers für schlüssig hielt. Das OLG räumte verschiedene rechtliche Einwände gegen solche Klagen aus dem Weg, wodurch der Weg für künftige Klimaklagen grundsätzlich freigemacht wurde.
Herausforderungen: Gerichte stützen sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse (z.B. kumulierte Emissionen). Die Hauptschwierigkeit in diesen Verfahren ist jedoch der Nachweis der Kausalität (Ursachenzusammenhang) und die Zurechnung des konkreten Schadens zu der Verursacherhandlung, vermittelt durch den Klimawandel.
5. Lösungsansätze und Forderungen.
Obwohl die individuelle Klage (individuelle Klimagerechtigkeit) Grenzen hat, da das Klimaproblem ein strukturelles Problem ist, können Klimaklagen den Druck auf den Gesetzgeber und die Großemittenten erhöhen.
5.1 Politische und Fiskalische Forderungen.
Um das strukturelle Problem zu lösen, ist der politische Prozess gefragt, da Gerichte institutionell nicht für Strukturmaßnahmen gedacht sind.
- Druck auf Unternehmen: Hohe Schadensersatzzahlungen oder einbrechende Aktienwerte (durch Klagewellen) können Großemittenten dazu bewegen, interne strukturelle Maßnahmen zu ergreifen.
- Vermögens- und Übergewinnsteuern: Oxfam schlägt starke Vermögenssteuern für die Superreichen oder Übergewinnsteuern vor, insbesondere bei Unternehmen, die fossile Brennstoffe herstellen und in Krisenzeiten zweistellige Milliardenbeträge an Gewinnen verzeichnen.
- Eine 60%ige Steuer auf die Einkommen des reichsten 1% würde laut Oxfam jährlich mehr als 6 Billionen Dollar (präzise 6,4 Billionen Dollar oder 6.400 Milliarden Dollar) einspielen. Diese Einnahmen könnten die globalen Emissionen um knapp 700 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.
5.2 Appelle und Maßnahmen.
Es wird an die Milliardäre und Millionäre appelliert, sich "wie Menschen" zu verhalten und nicht wie Monster, da ihr Geld nutzlos ist, wenn die Welt zerstört wird. Gerechtigkeit bedeutet, dass möglichst viele Menschen ein möglichst menschliches Leben führen können.
Als Beispiel für konkrete Maßnahmen wird die Entscheidung der Stadt Amsterdam genannt, ihren Flughafen zukünftig für Privatflugzeuge zu sperren.
Das Fazit des Arguments, dass individuelle Emissionen keine Rolle spielen, ist klar: So wie es falsch wäre, keine Steuern mehr zu zahlen, weil der eigene Beitrag gering ist, muss auch im Klimaschutz die Verantwortung wahrgenommen werden. Der Staat benötigt das Geld zur Finanzierung von Klimaanpassungs- und Infrastrukturmaßnahmen.
Das Ungleichgewicht zwischen Verursacher und Betroffenen.
Vielen Dank an Kanal Terra X und Prof. Dr. Harald Lesch:
https://www.youtube.com/@TerraXLeschundCo
Übersichtsseiten mit Inhaltsverzeichnissen.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.