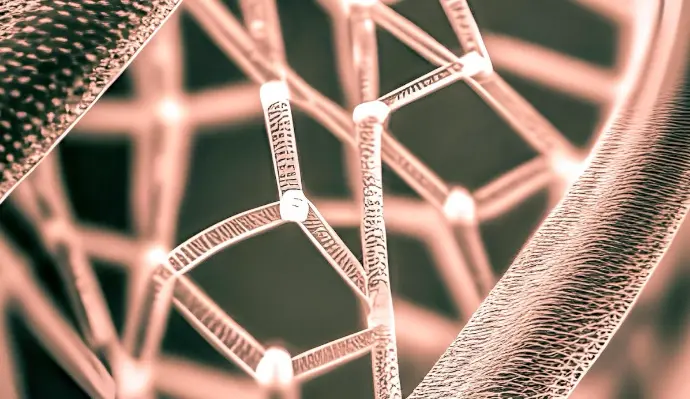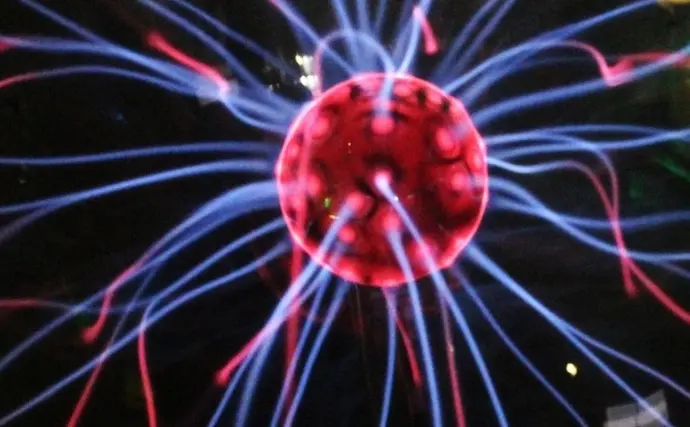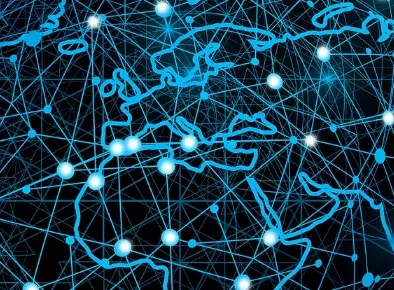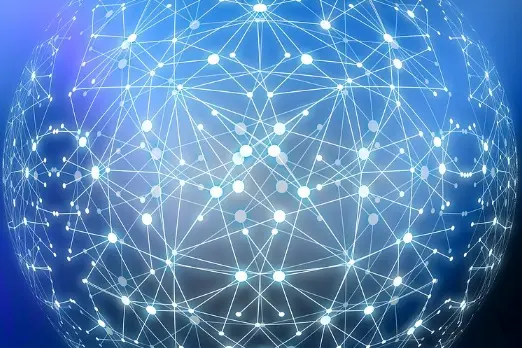E-Autos und Batterien von A-Z - wie Elektromobilität, Lithium-Ionen- versus Natrium-Ionen-Batterien, Recycling.
29.7.2025
Maximilian Fichtner, Experte für Batterieforschung, bietet einen umfassenden Überblick über Lithium-Ionen-Batterien. Es werden grundlegende Konzepte wie die Bestandteile einer Batteriezelle, die Unterscheidung zwischen Akku, Batteriezelle, -modul und -pack sowie die verschiedenen Zellchemien erläutert.
Batterien und Elektroautos von A-Z.
Das Gespräch
beleuchtet zudem praktische
Aspekte wie die Anwendung von Batterien in verschiedenen
Bereichen, die Entwicklung von Reichweiten bei Elektroautos und die
Herausforderungen beim Laden. Darüber hinaus werden aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der
Batterietechnologie diskutiert, darunter Festkörperbatterien, alternative
Materialien wie Natrium-Ionen-Batterien, Nachhaltigkeitsfragen, die
Preisentwicklung und das Recycling. Schliesslich geht es auch um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Elektromobilität,
insbesondere auf den Arbeitsmarkt und die Bedeutung von Batterieunternehmen.
A wie „Akku-Anwendungen“ – Wo sind die Grenzen der Lithium-Batterien?
Wo werden Lithium-Ionen-Batterien heute eingesetzt?
Lithium-Ionen-Batterien sind mittlerweile überall dort zu finden, wo man gut wieder aufladen kann oder muss. Ihre Vielseitigkeit hat sie zu einer Schlüsseltechnologie in zahlreichen Bereichen gemacht:
Stationäre Speicher:
Sie werden sowohl als Hausspeicher als auch als grosse, netzdienliche Speicher eingesetzt, um beispielsweise Solar- oder Windenergie zu speichern.
Elektromobilität:
Der wohl bekannteste Einsatzbereich sind Elektroautos. Aber auch Baumaschinen und die ersten landwirtschaftlichen Geräte setzen zunehmend auf diese Technologie.
Alltagsgeräte und Werkzeuge:
Viele elektronische Geräte und Werkzeuge des täglichen Gebrauchs nutzen Lithium-Ionen-Batterien. Dazu gehören Bohrmaschinen, Staubsauger und auch Drohnen.
Wo liegen die Grenzen der Lithium-Ionen-Batterie?
Obwohl Lithium-Ionen-Batterien eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht haben, gibt es immer noch Bereiche, in denen sie aufgrund spezifischer Anforderungen nicht die erste Wahl sind oder traditionell nicht wiederaufladbare Batterien bevorzugt wurden. Dies betrifft vor allem Hochleistungsanwendungen, die extreme Langlebigkeit oder sehr spezifische Leistungsmerkmale erfordern.
Medizinische Geräte:
Ein klassisches Beispiel sind Herzschrittmacher oder Hörgeräte. Hier wurden bisher grösstenteils nicht wiederaufladbare Batterien verwendet. Der Hauptgrund dafür ist ihre extreme Langlebigkeit: Batterien für Herzschrittmacher haben beispielsweise Garantien von bis zu 17 Jahren. Für solche super hochleistungsfähigen Anwendungen, die vielleicht kleinere Batterien erfordern, wird oft auf nicht wiederaufladbare Batterien gesetzt.
Entwicklungen in der Medizintechnik:
Es scheint jedoch, dass auch im Bereich der medizinischen Geräte an wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien gearbeitet wird. Dies könnte bedeuten, dass die Technologie zukünftig auch diese Nische erobert, sobald die Anforderungen an Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen erfüllt werden können.
Lithium-Ionen-Batterien werden dort benötigt, wo häufiges Wiederaufladen möglich und erwünscht ist. Ihre Grenzen liegen derzeit noch in sehr spezifischen Hochleistungsanwendungen, die extrem lange Betriebszeiten ohne Wartung oder Batteriewechsel erfordern. Die Forschung und Entwicklung arbeiten jedoch kontinuierlich daran, diese Grenzen zu verschieben.
B wie "Batteriezelle" – Unterschied zwischen Batterie-Zelle, Batterie-Modul und Batterie-Pack.
Die Batteriezelle:
Das Herzstück der Energiespeicherung. Die Batteriezelle ist die kleinste Speichereinheit einer Batterie. Man kann sie sich als eine grundlegende elektrochemische Einheit vorstellen.
Aufbau:
Eine Batteriezelle besteht aus einer beschichteten Pluspol-Folie (Kathode), einer anderen beschichteten Minuspol-Folie (Anode), einer Trennfolie dazwischen (um Kurzschlüsse zu verhindern) und einem flüssigen Elektrolyten.
Die Elektroden (Kathode und Anode) sind dabei eine Schicht aus Speichermaterial, das mit Kohlenstoff und einem Klebstoff gemischt ist, aufgetragen auf eine Metallfolie (Aluminium für die Kathode, Kupfer für die Anode). Diese Schicht ist etwa "etwas dicker als ein menschliches Haar".
Funktion:
In diesem "Regal" aus Speichermaterial können Lithiumionen ein- und ausschlüpfen, wenn die Batteriezelle be- oder entladen wird.
Anwendungen:
Für kleinere Anwendungen, wie zum Beispiel Handys, wird oft nur eine einzige Batteriezelle verwendet.
Zellchemien und Energiedichte:
Es gibt verschiedene Zellchemien, die die Energiedichte (wie viel Energie pro Gewicht oder Volumen gespeichert werden kann) beeinflussen.
Lithium-Eisenphosphat (LFP):
Hat derzeit die geringste Energiedichte bei Lithium-Ionen-Batterien (ca. 205-210 Wattstunden pro Kilogramm), ist aber im Kommen, da sie billiger, sicherer und langlebiger ist. Sie kann auch voll ent- oder beladen werden, ohne das Material auf Dauer zu schädigen.
Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC):
Wird in Europa und den USA noch häufig für Pkws verwendet, auch wenn der Kobaltanteil reduziert wurde.
Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA):
Wurde eine Zeit lang auch von Tesla verwendet.
Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP):
Ist ebenfalls im Kommen und kann die Reichweite um 10-15% erhöhen, während sie billig ist.
Für kleinere Geräte wie Handys oder Laptops findet man teilweise noch reines Kobaltoxid.
Zukunftsausblick:
Fortschritte wie die "Condensed Battery" von CATL streben 500 Wattstunden pro Kilogramm an, und erste "Semi-Solid-State"-Batterien sollen bis zu 360 Wattstunden pro Kilogramm erreichen.
Volumetrische vs. Gravimetrische Energiedichte:
Während in der Presse oft die gravimetrische Energiedichte (Energie pro Kilogramm) genannt wird, ist die volumetrische Energiedichte (Energie pro Liter) bei Pkws, Handys und Notebooks das entscheidendere Kriterium, da der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist. Schwere Materialien wie NMC oder Kobaltoxid werden oft verwendet, weil sie am wenigsten Platz einnehmen. Die Entwicklung ist hier enorm: Von 88 Wattstunden pro Liter im Jahr 2008 auf bis zu 700 Wattstunden pro Liter heute in Batteriepacks.
Das Batteriemodul:
Die erste Bündelung. Wenn man mehrere Batteriezellen (je nach Hersteller z.B. 12 oder 20 Stück) in einen Kasten stellt und diese alle miteinander verbindet, entsteht eine grössere Einheit, die als Modul bezeichnet wird. Zweck: Module dienen als Basis, um grosse Speicher aufzubauen.
Das Batteriepack:
Die Komplettlösung für die Anwendung. Das Batteriepack ist die grösste Einheit und das finale Produkt für die Anwendung, insbesondere in Elektrofahrzeugen.
Aufbau:
Es entsteht, indem verschiedene Module in einem grösseren Kasten platziert werden.
Herstellerstrategien:
Manche Hersteller, wie BYD oder CATL, setzen vermehrt auf sogenannte "Cell-to-Pack"-Designs, bei denen die Batteriezellen direkt in das Pack integriert werden, ohne den Zwischenschritt über Module, um mehr Raum für das aktive Material zu schaffen und so eine höhere Energiedichte zu erreichen.
Bedeutung für E-Autos:
Die Reichweite eines Elektroautos wird durch die Anzahl der Module im Batteriepack und somit die Speicherkapazität bestimmt.
Kosten:
Eine grosse Traktionsbatterie für ein E-Auto kostet in der Herstellung heute noch zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Der Preis pro Kilowattstunde für ein komplettes Pack liegt zwischen 60 und 110 US-Dollar, was unter der lange als entscheidend angesehenen Marke von 100 US-Dollar pro Kilowattstunde liegt, ab der E-Autos billiger werden könnten als Verbrenner.
Integration:
Heimspeicher werden oft von Automobilherstellern angeboten, was zeigt, dass die Basiszellen der Packs für Fahrzeuge und stationäre Speicher in der Regel ähnlich sind. Die Grenzen zwischen E-Auto-Akkus und Heimspeichern zerfliessen sogar bei Konzepten wie "Vehicle to Grid" oder "Vehicle to Home".
Das Zusammenspiel von Batteriezellen, Modulen und Packs ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Effizienz moderner Batteriesysteme ist. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, von der Zellchemie bis zur Pack-Architektur, treibt die Elektromobilität und die Energiespeicherung stetig voran.
C wie "Batterie-Chemie" – Welche LiB-Batteriechemien werden derzeit für E-Autos weiterentwickelt?
Die Batteriezellchemie bestimmt massgeblich, wie viel Energie eine Zelle speichern kann (Energiedichte), wie lange sie hält (Zyklenfestigkeit), wie sicher sie ist und welche Kosten sie verursacht. Im Bereich der Elektroautos werden derzeit verschiedene Lithium-Ionen-Zellchemien intensiv weiterentwickelt.
Lithium-Eisenphosphat (LFP):
Diese Chemie hat in den letzten Jahren stark an Boden gewonnen.
Vorteile:
LFP-Batterien sind billiger, sicherer und langlebiger. Ein grosser Vorteil ist, dass sie vollständig entladen oder beladen werden können, ohne das Material auf Dauer zu schädigen oder es besonders altern zu lassen.
Energiedichte:
LFP hat derzeit die geringste Energiedichte unter den Lithium-Ionen-Batterien, liegt aber bei etwa 205-210 Wattstunden pro Kilogramm. Hersteller wie CATL haben angekündigt, mit LFP-Zellen bereits Werte nahe der theoretischen Dichte zu erreichen, was Reichweiten von 600-800 km in Elektroautos ermöglichen kann.
Kälteverhalten:
Bei tiefen Temperaturen sind LFP-Batterien im Vergleich zu Natrium-Ionen-Batterien schlechter.
Trend:
Angesichts des Preiskampfes im Markt könnte LFP immer mehr Raum gewinnen.
Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC):
Diese Chemie wird in Europa und den USA immer noch häufig für Pkws verwendet, auch wenn der Kobaltanteil in verschiedenen Konfigurationen reduziert wurde.
Kritik:
Es gibt Stimmen, die meinen, NMC könnte für E-Autos komplett aussterben, da es teurer ist als Lithium-Eisenphosphat.
Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA):
Diese Chemie wurde eine Zeit lang auch von Tesla verwendet.
Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP):
LMFP ist eine Weiterentwicklung von LFP, die einen Mangananteil enthält.
Vorteile:
Sie kann die Reichweite bzw. Speicherkapazität um 10-15% erhöhen und ist dabei billig. Ford oder General Motors treiben die Entwicklung dieser Chemie voran.
Reines Kobaltoxid:
Für kleinere Anwendungen wie Handys oder Laptops findet man teilweise noch reines Kobaltoxid. Für E-Autos ist es aufgrund der Eigenschaften und Materialkosten jedoch weniger relevant.
Energiedichte:
Gravimetrisch versus Volumetrisch: Wenn es um die Leistungsfähigkeit von Batterien geht, insbesondere in Fahrzeugen, sind zwei Begriffe wichtig:
Gravimetrische Energiedichte:
Misst, wie viel Energie pro Kilogramm (Wattstunden pro Kilogramm, Wh/kg) gespeichert werden kann. Dies wird häufig in der Presse genannt.
Volumetrische Energiedichte:
Misst, wie viel Energie pro Liter (Wattstunden pro Liter, Wh/L) gespeichert werden kann. Dies ist bei Pkws, Handys und Notebooks oft das entscheidendere Kriterium, da der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist. Schwere Materialien wie NMC oder Kobaltoxid werden oft verwendet, weil sie am wenigsten Platz einnehmen.
Es gab eine enorme Entwicklung in der volumetrischen Energiedichte von Batteriepacks in Autos: Von 88 Wh/L im Jahr 2008 auf bis zu 700 Wh/L heute. Dies ist das Ergebnis klassischer Ingenieursleistung, die es geschafft hat, Batteriezellen optimal zu integrieren und durch ausgeklügelte Kühlung viel Energie auf kleinem Raum zu speichern.
Innovationen und zukünftige Trends.
Die Forschung und Entwicklung steht nicht still:
Neue Zelltypen:
Firmen wie Wion, eine chinesische Firma, geben an, Semi-Solid-State-Batterien mit angeblich 360 Wh/kg anzubieten.
"Condensed Battery":
CATL hat die sogenannte "Condensed Battery" mit angekündigten 500 Wh/kg vorgestellt. Hier muss sich jedoch noch zeigen, wie lange die Zyklenfestigkeit hält und wie schnell sie beladen werden kann.
"Cell-to-Pack"-Design:
Hersteller wie BYD oder CATL nutzen verstärkt das "Cell-to-Pack"-Design, bei dem Batteriezellen direkt in das Batteriepack integriert werden, ohne den Zwischenschritt über Module. Dies schafft mehr Raum für aktives Material und erhöht die Energiedichte im Pack. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Batteriezellchemien und der Pack-Architekturen treibt die Elektromobilität stetig voran und verschiebt die Grenzen dessen, was möglich ist.
D wie „Dichte“ – Was sind hier die aktuellsten Zahlen für Lithium-Batterien (LFP, NMC, Festkörperbatterien)?
Wenn es um die Energiedichte von Batterien geht, werden oft zwei Begriffe verwendet, die unterschiedliche Aspekte beleuchten: die gravimetrische und die volumetrische Energiedichte.
Gravimetrische Energiedichte (Wh/kg):
Dieser Wert gibt an, wie viel Energie pro Kilogramm des Batterie-Materials gespeichert werden kann.
Er wird häufig in der Presse und Literatur genannt.
Ein hoher Wert bedeutet, dass die Batterie bei geringem Gewicht viel Energie speichern kann, was beispielsweise für Drohnen oder die Luftfahrt entscheidend ist.
Volumetrische Energiedichte (Wh/L):
Dieser Wert misst, wie viel Energie pro Liter Volumen (Raum) die Batterie einnimmt.
Für Anwendungen wie PKWs, Handys und Notebooks ist die volumetrische Energiedichte das entscheidendere Kriterium, da der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist.
Interessanterweise werden deshalb oft schwere Materialien wie NMC oder Kobaltoxid verwendet, weil sie am wenigsten Platz wegnehmen. Ein kleiner Handy-Akku benötigt beispielsweise wenig Volumen.
Die Entwicklung in der volumetrischen Energiedichte von Batteriepacks in Autos war enorm: Von 88 Wattstunden pro Liter im Jahr 2008 auf bis zu 700 Wattstunden pro Liter heute. Das ist ein Faktor von etwa 8 und resultiert aus klassischer Ingenieursleistung, die es geschafft hat, Batteriezellen optimal zu integrieren und durch ausgeklügelte Kühlung viel Energie auf kleinem Raum zu speichern.
Energiedichte der aktuellen Lithium-Ionen-Zellchemien
Schauen wir uns die Dichtewerte der wichtigsten Zellchemien an, die für E-Autos weiterentwickelt werden:
Lithium-Eisenphosphat (LFP):
LFP-Kathoden haben derzeit die geringste Energiedichte unter den Lithium-Ionen-Batterien.
Aktuell liegt die gravimetrische Energiedichte bei etwa 205-210 Wattstunden pro Kilogramm.
Hersteller wie CATL haben angekündigt, mit LFP-Zellen Werte zu erreichen, die nahe an der theoretischen Dichte dieses Materials liegen. Mit solchen Werten können in Elektroautos Reichweiten von 600-800 km erzielt werden.
Obwohl LFP eine geringere Energiedichte aufweist, gewinnt es stark an Bedeutung, da es billiger, sicherer und langlebiger ist und vollständig ent- oder beladen werden kann, ohne das Material zu schädigen.
Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC) und Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA):
Diese Chemien werden in Europa und den USA weiterhin häufig für PKWs verwendet.
Sie bieten eine höhere Energiedichte und nehmen weniger Platz ein als LFP.
(Spezifische gravimetrische Dichtewerte für NMC/NCA im Vergleich zu LFP werden in den Quellen nicht direkt als absolute Zahlen genannt, aber es wird impliziert, dass sie höher sind als LFP, während LFP die "geringste Energiedichte" hat).
Lithium-Mangan-Eisenphosphat (LMFP):
LMFP ist eine Weiterentwicklung von LFP, die durch den Zusatz von Mangan die Reichweite bzw. Speicherkapazität um 10-15% erhöhen kann, während sie weiterhin kostengünstig ist.
Festkörperbatterien und zukünftige Entwicklungen
Semi-Solid-State-Batterien:
Die chinesische Firma Wion bietet angeblich Semi-Solid-State-Batterien an, die eine gravimetrische Energiedichte von 360 Wattstunden pro Kilogramm erreichen sollen – eine beachtliche Steigerung.
"Condensed Battery" von CATL:
CATL hat eine sogenannte "Condensed Battery" mit einer angekündigten Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm vorgestellt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie es um die Zyklenfestigkeit und die Ladegeschwindigkeit dieser Zellen bestellt ist, da hierzu noch keine Angaben gemacht wurden.
Die Entwicklung von Batterien zeigt eine kontinuierliche Verbesserung:
Pro Jahr gibt es etwa 6 % Verbesserung in der Speicherkapazität auf dem Markt, und dieser Trend hält an.
Manche Eigenschaften sind allerdings gegenläufig:
Eine höhere Speicherkapazität durch dickere Elektrodenschichten kann zu langsameren Ladezeiten führen.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Batteriezellchemien und der Pack-Architekturen ist entscheidend, um die Leistung von Elektrofahrzeugen zu verbessern und die Elektromobilität voranzutreiben.
E wie "E-Auto-Reichweiten" – Wie weit fahren die neusten E-Autos?
Die Reichweite eines Elektroautos war lange Zeit ein Punkt der Skepsis und sogar der Spott, wie das berühmte Zitat "Bis das geladen ist, kannst du Krieg und Frieden lesen" zeigt. Doch die Zeiten haben sich dramatisch geändert.
Die Entwicklung der Reichweite:
Erinnern wir uns an die Anfänge der Elektromobilität, als ein Fahrzeug wie der BMW i3 im Winter vielleicht gerade einmal 150 km Reichweite bot. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Die Batterietechnologie hat enorme Fortschritte gemacht, was sich direkt in der Reichweite widerspiegelt:
Aktuelle Spitzenmodelle:
Moderne Elektrofahrzeuge, wie sie beispielsweise von Tesla, Polestar oder Mercedes-Benz auf den Markt gebracht werden, erreichen beeindruckende Distanzen. Ein aktuelles Fahrzeug von Mercedes soll laut WLTP-Standard bis zu 792 Kilometer Reichweite bieten. Diese Reichweite wird nicht nur durch die Batterieentwicklung erreicht, sondern auch durch ein extrem energiesparendes Fahrzeugdesign, das einen Verbrauch von nur 12 bis 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ermöglicht – ein sensationeller Wert.
Chinesische Hersteller als Vorreiter:
Besonders im chinesischen Markt gibt es Fahrzeuge, wie den Zeekr 001, die auf Basis von Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterien angeblich über 1000 Kilometer Reichweite erreichen sollen. Dies ist bemerkenswert, da LFP-Batterien historisch als die mit der geringsten Energiedichte galten, aber dank kontinuierlicher Entwicklung inzwischen Werte von etwa 205-210 Wattstunden pro Kilogramm erreichen, was nahe an der theoretischen Dichte liegt und Reichweiten von 600-800 km ermöglicht.
Der Einfluss der Energiedichte:
Wie in unserer letzten Folge zu "D wie Dichte" besprochen, ist die Energiedichte entscheidend. Die kontinuierliche Verbesserung der gravimetrischen Energiedichte (Wh/kg) und der volumetrischen Energiedichte (Wh/L) in den Batterien ist der Haupttreiber für diese gesteigerten Reichweiten. Durch optimiertes Pack-Design, wie das "Cell-to-Pack"-Konzept von BYD oder CATL, kann mehr aktives Material untergebracht werden, was die Energiedichte im gesamten Batteriepack erhöht und somit die Reichweite steigert.
Überholmanöver der E-Autos:
Interessanterweise haben Elektroautos in puncto Reichweite sogar die lange Zeit technologisch führenden Wasserstoffautos überholt. Während ein Hyundai Nexo oder der neue Mirai heute noch etwa 500-550 km Reichweite bieten, haben die Batteriefahrzeuge diese Werte inzwischen deutlich übertroffen.
Die Reichweite ist heute weniger eine Frage der technischen Machbarkeit, sondern oft eine des Geldbeutels. Mit den neuesten Entwicklungen gehören die Sorgen um die Reichweite der Vergangenheit an, und die Elektromobilität wird für immer mehr Menschen zur attraktiven Alternative.
F wie „Festkörperbatterien“ – Hand auf’s Herz: Wird es diese „Festkörperbatterie“ jemals geben?
Der Begriff Festkörperbatterie geistert schon lange durch die Medien und verspricht höhere Reichweiten, schnellere Ladezeiten und vor allem mehr Sicherheit. Doch was steckt wirklich dahinter, und wie weit ist die Entwicklung?
Was sind Festkörperbatterien?
Grundsätzlich gibt es einen "ganzen Zoo an Ausführungen von Batterien, die alle irgendwie Festkörperbatterien genannt werden". Die reine Festkörperbatterie im ursprünglichen Sinne wäre eine Batterie, die im Inneren rein keramische Materialien enthält, beispielsweise Oxide. Ihr grosser Vorteil: Sie wäre nach diesem Verständnis nicht mehr entflammbar, da keine brennbaren flüssigen Elektrolyte mehr enthalten wären.
Allerdings ist die Umsetzung einer rein festen Batterie extrem schwierig und störanfällig. Wenn lauter Festkörper miteinander in Kontakt stehen und sich ein Teil ausdehnt, während ein anderer gleichbleibt, reissen diese Grenzflächen ab. Reissen die Grenzflächen ab, können keine Lithium-Ionen mehr hin- und hergeschoben werden, was jedoch die Grundlage für die Funktion einer Batterie ist.
Deshalb wird darüber nachgedacht, die Batterien nicht ganz so fest zu machen und sogenannte Semi-Solid-State-Batterien oder "almost Solid State Batteries" zu entwickeln. Hierbei werden die Grenzflächen durch eine Flüssigkeit oder ein Gel überbrückt, sodass die Batterie „fast fest“ ist.
Aktueller Stand und Herausforderungen.
Man liest ständig von neuen Meldungen über Giga-Factory-Pläne zur Produktion von Solid-State-Batterien. Doch in der Realität gibt es nur wenige Anwendungen, die tatsächlich marktreif oder in grosser Serie verfügbar sind. Auch wenn ein „berühmter Hersteller aus Stuttgart“ (vermutlich Mercedes-Benz in Kooperation mit Factorial) kürzlich eine Festkörperbatterie in einem Fahrzeug angepriesen hat, handelte es sich dabei um eine Kleinserie, die ausserhalb grosser Fabrikationsanlagen gefertigt wurde.
Zwar gibt es vielversprechende Ankündigungen bezüglich der Energiedichte:
Die chinesische Firma Wion bietet angeblich Semi-Solid-State-Batterien an, die eine gravimetrische Energiedichte von 360 Wattstunden pro Kilogramm erreichen sollen – eine beachtliche Steigerung.
CATL hat eine "Condensed Battery" mit einer angekündigten Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm vorgestellt.
Doch bei solchen Ankündigungen bleiben oft entscheidende Fragen offen:
Es gibt keine Angaben zur Zyklenfestigkeit oder zur realen Ladegeschwindigkeit. Das Narrativ, dass sich Festkörperbatterien schnell laden lassen, wurde in der Praxis noch nicht wirklich demonstriert.
Der Blick in die Zukunft:
Kommt sie wirklich? Die Batterieentwicklung zeigt eine kontinuierliche Verbesserung von etwa 6 % pro Jahr in der Speicherkapazität auf dem Markt, und dieser Trend hält an. Man braucht also keine "Wunderbatterie", da sich die Technologie durch Evolution und kleine Schritte stetig weiterentwickelt. Was früher als Wunderbatterie galt (z.B. 110 Wattstunden pro Kilo), ist heute längst überholt.
Allerdings gibt es bei Batterien gegenläufige Eigenschaften. Eine höhere Speicherkapazität erfordert zum Beispiel dickere Elektrodenschichten, was aber zu langsameren Ladezeiten führen kann, da die Lithium-Ionen längere Wege zurücklegen müssen. Für eine erfolgreiche Batterie müssen viele Parameter stimmen:
Sicherheit:
Festkörperbatterien versprechen hier einen grossen Vorteil, da keine brennbaren Flüssigkeiten mehr vorhanden sind. Elektroautos brennen laut US-Versicherern ohnehin etwa 30 Mal seltener als Verbrenner, und dieser Trend wird sich durch neue Regeln, die das Brennen von Batterien verbieten, noch verstärken.
Vorteile:
- Reichweite (durch hohe Speicherkapazität).
- Beladungsgeschwindigkeit.
- Preis: Der Preis ist ein entscheidender Faktor, der auch technisch reife Anwendungen wie Wasserstoffautos daran hindert, sich durchzusetzen.
- Nachhaltigkeit.
- Temperaturverhalten.
Die reine, ideale Festkörperbatterie, die alle genannten Vorteile ohne Kompromisse in sich vereint und massentauglich ist, ist noch Zukunftsmusik. Die Forschung arbeitet intensiv daran, und es gibt bereits vielversprechende Teilerfolge in Form von Semi-Solid-State-Batterien und erhöhten Energiedichten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die restlichen Eigenschaften wie Zyklenfestigkeit und Ladegeschwindigkeit in der Praxis überzeugen können.
G wie „Grossbatterien“ – Was sind Grossbatterien?
Der Begriff "Grossbatterien" bezieht sich auf grosse Batteriespeicher, die dazu dienen, unser Stromnetz zu stabilisieren und die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen. Es wimmelt bereits von solchen Anlagen, allerdings leider noch nicht so stark in Deutschland wie in anderen Regionen der Welt.
Anwendungen und Beispiele:
Unterstützung der Energiewende:
Grossbatterien sind entscheidend für Länder und Regionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, zu 100% auf erneuerbare Energien umzustellen. Ein Beispiel hierfür ist Westaustralien, wo riesige Batterien in der Ausführung und Planung sind, um mit Photovoltaik kombiniert zu werden und das Land bis Ende des Jahrzehnts unabhängig von Kohle und Gas zu machen.
Netzdienliche Speicher:
In Deutschland gibt es viele sogenannte Netzanschlussanfragen für Grossbatterien. Solche Speicher könnten unser Netz stützen und dezentral zur Verfügung stehen. Ein Übertragungsnetzbetreiber (wie 50 Hz, der in einem früheren Podcast erwähnt wurde) hat demonstriert, wo im Augenblick der Hase im Pfeffer liegt.
Herausforderungen in Deutschland:
Die Betreiber der Stromnetze sind in Deutschland noch etwas zögerlich, da sie vielleicht kein richtiges Geschäftsmodell für sich entdecken, da diese Speicher dezentral arbeiten und sie somit die Sache nicht mehr so stark regulieren können. Es ist zudem wichtig, dass Grossbatterien netzdienlich sind, was sowohl die richtige Platzierung als auch die Entwicklung von Preismodellen zur Förderung dieser Netzdienlichkeit erfordert, ohne dass dadurch andere Akteure kostenmässig zu Schaden kommen.
Unterschiede zu Heimspeichern und E-Auto-Batterien:
Während die Grossbatterien für das Stromnetz ausgelegt sind, gibt es auch Heimspeicher, die eine etwas kleinere Kategorie darstellen, aber im Kern sehr ähnliche Batteriezellen wie Elektroautos verwenden. Viele Automobilhersteller bieten sogar Heimspeicher an, wie beispielsweise Tesla oder Mercedes.
Zellchemie:
Ein Trend bei stationären Speichern, einschliesslich Heimspeichern, ist die verstärkte Nutzung von Lithium-Eisenphosphat (LFP). Dies liegt daran, dass LFP-Batterien billiger, sicherer und langlebiger sind. Sie können vollständig entladen oder beladen werden, ohne dass das Material auf Dauer Schaden erleidet oder besonders altert.
Umgebungsbedingungen:
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Regelung und dem Umfeld, in dem die Batterien betrieben werden. Ein Heimspeicher arbeitet in einem viel stabileren Umfeld, oft bei 15 bis 20 Grad im Keller, während eine E-Auto-Batterie extremen Temperaturschwankungen (von +40°C bis -20°C) und variablen Beladungszuständen ausgesetzt ist. Diese Belastungen stellen eine grosse Herausforderung für den Fahrzeugspeicher dar.
Die Grenzen zwischen E-Auto-Akkus und Heimspeichern verschwimmen zudem durch Konzepte wie Vehicle to Grid (V2G) oder Vehicle to Home (V2H), bei denen Elektroautos auch als flexible Stromspeicher für das Haus oder das Netz dienen könnten.
Die Entwicklung im Bereich der Grossbatterien schreitet stetig voran und ist ein wesentlicher Pfeiler für eine stabile und nachhaltige Energieversorgung in der Zukunft.
H wie "Heimspeicher" – Was ist der grosse Unterschied zwischen Batterien für Heimspeicher und E-Autos?
Heimspeicher sind eine kleinere Kategorie im Vergleich zu den riesigen Grossbatterien, die unser Stromnetz stabilisieren. Dennoch spielen sie eine entscheidende Rolle für die Energiewende in den eigenen vier Wänden, indem sie beispielsweise Solarstrom vom Dach speichern. Im Kern sind die Batterien für Heimspeicher und Elektroautos sehr ähnlich. Interessanterweise bieten sogar viele Automobilhersteller wie Tesla oder Mercedes-Benz Heimspeicher an, was darauf hindeutet, dass die Basiszellen in der Regel für beide Anwendungen verwendet werden können.
Doch wo liegen dann die Unterschiede, die Heimspeicher von E-Auto-Batterien abgrenzen?
Die entscheidenden Unterschiede liegen hauptsächlich in der Zellchemie-Wahl und den Betriebsbedingungen:
Zellchemie:
Der LFP-Trend Ein klarer Trend bei stationären Speichern, einschliesslich Heimspeichern, ist die verstärkte Nutzung von Lithium-Eisenphosphat (LFP). Dies hat mehrere Vorteile:
- Billiger: LFP-Batterien sind kostengünstiger in der Herstellung.
- Sicherer: Sie gelten als inhärent sicherer als andere Lithium-Ionen-Chemikalien.
- Langlebiger: LFP-Batterien sind besonders langlebig und können vollständig entladen oder beladen werden, ohne dass das Material auf Dauer Schaden nimmt oder besonders altert.
Während LFP auch in Elektroautos immer häufiger zum Einsatz kommt – insbesondere bei günstigeren Modellen oder solchen, die auf maximale Reichweite verzichten, um Kosten zu sparen – ist es bei Heimspeichern aufgrund der genannten Vorteile ein noch dominanterer Trend.
Umgebungsbedingungen und Betriebsregelung.
Dies ist wohl der grösste Unterschied. Eine E-Auto-Batterie ist extremen und wechselhaften Bedingungen ausgesetzt:
Temperaturschwankungen:
Sie muss bei Temperaturen von +40°C bis -20°C oder sogar noch extremer zuverlässig funktionieren und ent- bzw. beladen werden.
Variable Belastungen:
Im Fahrzeug unterliegt sie ständig wechselnden Entlade- und Beladezuständen, schnellen Beschleunigungen und Rekuperationen, was eine hohe Belastung für den Speicher darstellt.
Ein Heimspeicher hingegen arbeitet in einem viel stabileren Umfeld. Steht er beispielsweise im Keller, herrschen dort meist konstante Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius, was einen wesentlich stabileren und weniger belastenden Betrieb ermöglicht. Dies vereinfacht die Kühlung und Temperierung erheblich.
Die Grenzen zwischen E-Auto-Akkus und Heimspeichern beginnen jedoch durch Konzepte wie Vehicle to Grid (V2G) oder Vehicle to Home (V2H) zu verschwimmen. Hierbei könnten Elektroautos nicht nur das Haus mit Strom versorgen, sondern sogar als flexible Energiespeicher ins Stromnetz zurückspeisen. Dies würde eine neue Dimension der Flexibilität und Netzdienlichkeit eröffnen, erfordert aber auch eine Anpassung der Regelung und möglicherweise der Temperaturkontrolle, falls das E-Auto ausserhalb der Garage als Quartierspeicher dient.
Die Entwicklung im Bereich der Heimspeicher schreitet also stetig voran, und ihre Rolle in der dezentralen Energiewende wird immer wichtiger.
I wie "Industrie/Gigafactories" – Werden deutsche Batterie- und E-Auto-Bauer erfolgreich sein?
Oft entsteht der Eindruck, dass grosse Batteriefabriken, sogenannte Gigafactories, in Deutschland abgesagt wurden, was schade ist, da wir natürlich unsere eigenen Batteriezellen in Europa herstellen wollen. Doch wie sieht die Situation wirklich aus, und werden die deutschen Batterie- und E-Auto-Hersteller hier erfolgreich sein können?
Die Antwort lautet:
Ja, es sieht so aus, als könnten sie erfolgreich sein, wenn sie kooperieren.
Es gibt verschiedene Ansätze, wie die deutschen Akteure in diesem wettbewerbsintensiven Feld bestehen können:
Kooperationen:
Der Erfolg hängt massgeblich von der Zusammenarbeit ab.
In-House-Lösungen:
Es gibt auch Bestrebungen, Batteriezellen in Eigenregie zu entwickeln und zu produzieren.
Weiterverarbeitung von Zellen:
Automobilhersteller können weiterhin punkten, indem sie bereits entwickelte Batteriezellen nehmen und diese dann zu Batteriepäcken weiterverarbeiten, um sie in ihren Fahrzeugen einzusetzen.
Das BMW-Modell:
Ein besonders interessanter Ansatz, wie ihn beispielsweise BMW verfolgt, ist die Auslagerung der Gigafactory-Produktion, während die Zellentwicklung im eigenen Haus verbleibt. Das bedeutet, eine Firma entwickelt die Zelle mit bestimmten Eigenschaften, Zellchemie und Performance und beauftragt dann einen externen Hersteller, diese Zellen in grossen Mengen zu den garantierten Spezifikationen zu produzieren. Dies ist nicht ungewöhnlich und erlaubt es dem Unternehmen, eine gewisse Kontrolle über das Endprodukt zu behalten und die Eigenschaften ihrer Fahrzeuge besser zu planen.
Ein Blick über die Grenzen:
Im internationalen Vergleich gibt es noch Aufholbedarf. Während es in Deutschland eher Forschungsprojekte zum Bau eigener Gigafactories gibt, sind die Franzosen hier bereits weiter. Sie bauen eigene Gigafactories und planen sogar eine Fabrik für Natrium-Ionen-Batterien. Auch im Bereich der Grossbatterien wurde bereits erwähnt, dass es in anderen Regionen wie Westaustralien bereits "wimmelt" von solchen Anlagen, allerdings leider noch nicht so stark in Deutschland. Insgesamt bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die deutsche Batterieindustrie entwickelt. Die Hoffnung besteht, dass der Aufbau eigener Gigafactories auch hierzulande noch erfolgreich voranschreitet. Die Kooperation und kluge Strategien bei der Zellentwicklung und -produktion sind dabei entscheidende Faktoren für den Erfolg.
J wie "Batterie-Jobs" – Werden genügend Batteriejobs in Deutschland entstehen?
Die Einführung der Elektromobilität wirft in Deutschland oft die Frage auf, was mit den Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie geschieht, insbesondere in der Verbrennersparte. Es besteht die Sorge, dass zahlreiche Jobs gefährdet sind oder bereits wegfallen.
Die Realität ist vielschichtig.
Verlust von Arbeitsplätzen in der Verbrenner-Fertigung:
Elektroautos sind per se einfacher aufgebaut und haben viel weniger Teile als Verbrenner. Ein Verbrenner hat etwa 1300 bewegte Teile, während ein Elektroauto vielleicht nur 40 hat. Zudem sind E-Autos langlebiger und haben weniger Wartungsaufwand. Dies führt dazu, dass Haufen von Dingen wegfallen, die üblicherweise in Werkstätten gemacht wurden, wie Ölwechsel oder Bremsenwechsel, da E-Autos oft über One-Pedal-Driving automatisch verzögern. Unterm Strich werden dadurch in Deutschland etwa 100.000 Jobs durch die Einführung der Elektromobilität wegfallen.
Das grössere Risiko der Untätigkeit:
Was oft nicht genannt wird: Würden die Deutschen nicht auf die Elektromobilität umsteigen und auf dem Verbrenner beharren, dann würde dies auf Dauer etwa 800.000 Jobs kosten, da man von der weltweiten Entwicklung überrollt werden würde. Es handelt sich also um eine Wahl zwischen "Skylla und Charybdis", bei der Jobverluste unvermeidlich sind.
Entstehung neuer Arbeitsplätze:
Es wird weiterhin Jobs in der Elektromobilität geben, allerdings in anderen Bereichen. Insbesondere in der Entwicklung von Zulieferteilen für Elektrofahrzeuge, in der Kühlung, Elektrifizierung und bei Elektromotoren wird es weiterhin Arbeitsplätze geben. Stellen, die sich mit Getrieben und mechanischen Arrangements von Verbrennern beschäftigen, werden hingegen weniger werden.
Veränderte Berufsbilder und Automatisierung:
Auch im klassischen Autobau und für Mechatroniker werden weiterhin Leute gebraucht. Allerdings wird dort auch immer mehr durch Roboter übernommen. In China gibt es bereits Fabriken, in denen kein Licht mehr benötigt wird, weil keine Menschen mehr arbeiten, und die ersten solcher Fabriken gibt es auch in Deutschland.
Der Übergang zur Elektromobilität wird zu einem Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt führen. Es werden Jobs verloren gehen, insbesondere in der traditionellen Verbrenner-Produktion und -Wartung. Gleichzeitig werden jedoch neue Arbeitsplätze in der Entwicklung, Produktion und Wartung von Elektrofahrzeug-Komponenten entstehen. Der Erfolg hängt davon ab, wie gut Deutschland diesen Wandel aktiv gestaltet und in neue Technologien und Prozesse investiert.
K wie „Kathode & Anode" – Was sind Elektroden/Aktivmaterialien in einer Lithium-Batterie?
Wenn wir uns die Entwicklung einer Batteriezelle von A bis Z anschauen, dann sind die Kathode und die Anode die zentralen Elektroden, die für die Speicherung und Freisetzung von Energie verantwortlich sind. Sie ermöglichen den Fluss der Lithiumionen während des Ladens und Entladens. Im Kern bestehen diese Elektroden aus einem sogenannten Speichermaterial. Dieses Material ist der Ort, in den Lithiumionen "hineinschlüpfen" können, wenn die Batteriezelle geladen oder entladen wird – man kann es sich wie ein Regal vorstellen, in dem das Lithium gehalten wird.
Damit dieses Speichermaterial jedoch optimal funktioniert, wird es nicht pur verwendet. Für die Herstellung einer Elektrode wird das Speichermaterial gemischt mit:
Kohlenstoff:
Dieser wird hinzugefügt, damit das Material elektrisch leitfähig ist.
Klebstoff (Binder):
Ein Klebstoff ist notwendig, damit das Gemisch hinterher als feste, dünne Schicht auf eine Folie aufgetragen werden kann. Dieses Gemisch wird dann mit einer Flüssigkeit (entweder ein organisches Lösungsmittel oder Wasser) zu einer Paste verarbeitet. Diese Paste wird anschliessend auf eine Metallfolie gestrichen.
Die Kathode (Pluspol):
Beim Pluspol, der Kathode, ist die Metallfolie aus Aluminium. Sie sieht aus wie gewöhnliche Haushalts-Aluminiumfolie.
Die Anode (Minuspol):
Beim Minuspol, der Anode, wird Kupfer als Metallfolie verwendet.
Beide Folien erhalten eine schwarze Schicht, die etwas dicker ist als ein menschliches Haar. Diese Anordnung – die Schicht aus Speichermaterial, Kohlenstoff und Klebstoff auf der Metallfolie – nennt man dann die Elektrode. An dieser Elektrode kann man einen elektrischen Kontakt herstellen. Kurz gesagt, Kathode und Anode sind die aktiven Komponenten in der Batteriezelle, die durch ihre spezielle Zusammensetzung und Struktur das Aufnehmen und Abgeben von Lithiumionen ermöglichen und somit die Energie speichern.
L wie "Laden/Schnellladen" – Wie schnell geht das mittlerweile?
Eine der häufigsten Sorgen potenzieller E-Auto-Käufer war lange Zeit die Ladezeit. Die Frage, wie schnell ein Elektroauto geladen werden kann, ist für die Akzeptanz im Alltag von entscheidender Bedeutung. Auch wenn man ein E-Auto oft über Nacht zu Hause laden kann und die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke gering ist, möchte man doch die Möglichkeit haben, unterwegs schnell Energie nachzutanken. Die gute Nachricht ist: Das Laden von Elektroautos hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und wird immer schneller.
Aktuelle Entwicklungen und Technologien.
800-Volt-Architektur:
Der Trend geht ganz klar in Richtung einer 800-Volt-Architektur. Für Laien bedeutet das: Je höher die Spannung ist, desto mehr Leistung kann in die Batterie eingebracht werden. Dies ermöglicht es, viel mehr Energie pro Zeiteinheit in die Batterie zu pumpen.
"C"-Rate als Massstab:
Die Ladegeschwindigkeit wird oft in "C"-Raten angegeben.
4C bedeutet, dass die Batterie viermal pro Stunde beladen werden könnte, also in einer Viertelstunde komplett vollgeladen ist.
6C bedeutet, dass ein Fahrzeug innerhalb von nur 10 Minuten vollständig geladen werden könnte.
Beeindruckende Fortschritte:
Aktuelle Entwicklungen ermöglichen es bereits, Fahrzeuge mit 4C bis 6C zu laden. Kürzlich gab es sogar einen "Überbietungswettbewerb" zwischen den Firmen BYD und CATL, die angekündigt haben, in Verbindung mit speziellen Ladesäulen 500 Kilometer Reichweite in nur 5 Minuten nachladen zu können! Das ist praktisch so schnell wie Tanken.
Infrastrukturelle Anforderungen:
Um solche Geschwindigkeiten zu erreichen, sind jedoch auch Ladesäulen erforderlich, die elektrische Energie im Bereich von einem Megawatt in das Auto pumpen können. Laut Experten der Elektrotechnik ist dies technisch absolut machbar, und die Chinesen setzen dies bereits um.
Die Sorge um lange Ladezeiten gehört damit zunehmend der Vergangenheit an. Die Fortschritte im Bereich der Ladetechnologie sind enorm und tragen massgeblich dazu bei, Elektroautos alltagstauglicher und attraktiver zu machen.
M wie „Batterie-Materialien“ – Gibt’s materialseits Alternativen zu den Lithium-Batterien?
Die Lithium-Ionen-Batterie ist zweifellos die dominierende Technologie in vielen Anwendungsbereichen, doch die Forschung nach Alternativen schreitet unaufhaltsam voran. Insbesondere aufgrund der kritischen Rohstoffe und des Preises von Lithium wird intensiv an neuen Materialien und Batterietypen gearbeitet.
Die vielversprechendste Alternative: Natrium-Ionen-Batterien.
Was derzeit ganz klar im Kommen ist, ist die Natrium-Ionen-Batterie. Sie funktioniert im Prinzip ähnlich wie die Lithium-Ionen-Batterie:
- Sie nutzt Kohlenstoff im Minuspol (Anode) und Metalloxide im Pluspol (Kathode).
- Statt Lithiumionen wandern hier Natriumionen zwischen den Elektroden hin und her.
Vorteile und Herausforderungen von Natrium-Ionen-Batterien:
Geringere Speicherkapazität:
Natrium ist nicht so dicht gepackt wie Lithium und auch schwerer. Das führt dazu, dass Natrium-Ionen-Batterien per se eine geringere Speicherkapazität pro Gewicht oder Volumen aufweisen.
Vorteile bei Kälte:
Sie können bei sehr tiefen Temperaturen noch gut arbeiten, da sie Elektrolyte vertragen, die bei der Lithium-Batterie nicht verwendet werden können und die auch bei tiefen Temperaturen noch sehr flüssig sind.
Eine Natrium-Ionen-Batterie kann bei tiefen Temperaturen noch 90% ihrer Ladekapazität erreichen, während Lithium-Ionen-Batterien vielleicht nur noch 70% schaffen.
Sie verträgt ein breiteres Temperaturfenster, was bedeutet, dass die Kühlung und Temperierung weniger aufwendig sein muss. Dies ist ein grosser Vorteil bei der Betrachtung des Gesamtsystems.
Wettbewerb mit Lithium-Eisenphosphat (LFP):
Wenn man das Gesamtsystem betrachtet, also nicht nur die Batteriezelle isoliert, sondern auch die Betriebsbedingungen wie Temperaturmanagement, dann liegen die Werte von Natrium-Ionen-Batterien langsam in der Richtung von Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Dies könnte zu einem Technologiewechsel führen, insbesondere wenn Natrium-Ionen-Batterien schneller beladbar sind und bei tiefen Temperaturen ohne grosses Federlesen arbeiten, während LFP-Batterien bei Kälte schlecht sind. Es ist noch nicht klar, ob es dazu kommt, aber diese Möglichkeit sollte man nicht ausschliessen.
Weitere Materialien in der Forschung:
Neben Natrium wird auch an anderen Systemen geforscht, wie beispielsweise Batterien mit Magnesium, Kalium und Kalzium als Ladungsträger oder Chlorid als "Shuttle". Diese sind jedoch alle noch in der Forschung und stehen nicht kurz vor der Kommerzialisierung.
Insgesamt zeigt sich, dass die Batterieforschung weit über Lithium hinausgeht und vielversprechende Alternativen in der Entwicklung sind, die die Elektromobilität und stationäre Speicher in Zukunft weiter voranbringen könnten.
N wie „nachhaltig“ – Sind Lithium-Batterien denn heute schon „nachhaltig“?
Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass die Produktion eines Elektroautos, insbesondere der Batterie, einen so grossen "CO2-Rucksack" mit sich bringt, dass es sich nicht lohnt, von einem Verbrenner umzusteigen. Dieses Argument, das man auch als "Ich fahre meinen Diesel aus Nachhaltigkeitsgründen noch so lange wie möglich zu Ende" kennt, hält der Realität nicht mehr stand und ignoriert die rasanten Fortschritte in der Batterieproduktion und -nutzung.
Der CO2-Rucksack – Ein schrumpfendes Problem:
Der Vergleich:
Der Hauptunterschied im CO2-Fussabdruck zwischen einem Elektroauto und einem Verbrenner liegt in der Batterie und dem Antriebsstrang. Während der Antriebsstrang eines Verbrenners noch energieärmer herzustellen ist als eine Batterie, tut sich hier enorm viel.
Betriebsphase:
Elektroautos verbrauchen deutlich weniger Energie (Faktor 3 oder so) und fahren nicht mit 100% fossilem Kraftstoff, sondern mit einem Strommix, der einen immer geringeren Fossilanteil hat (derzeit vielleicht noch 30-40%). Das macht das E-Auto im Betrieb deutlich umweltfreundlicher.
Kürzere Amortisationszeit:
Frühere Studien (4-5 Jahre alt) gingen davon aus, dass ein Elektroauto je nach Batteriegrösse etwa 20.000 bis 50.000 Kilometer fahren muss, bis es in seiner Gesamtbilanz (Produktion + Betrieb) besser ist als ein Verbrenner. Durch zwei wesentliche Entwicklungen hat sich das drastisch verkürzt:
Einsatz erneuerbarer Energien:
Auto- und Batteriehersteller integrieren zunehmend erneuerbare Energien in ihre Produktionsprozesse.
Energiesparende Prozesse:
Auch die Produktionsprozesse selbst werden energieeffizienter gestaltet. Diese Massnahmen führen dazu, dass man heute nur noch etwa 10.000 bis 20.000 Kilometer fahren muss – in manchen Fällen sogar nur 8.000 Kilometer –, bis der "Kreuzungspunkt" erreicht ist und das Elektroauto die bessere CO2-Bilanz aufweist.
Langlebigkeit und Zweitnutzung:
Eine moderne E-Auto-Batterie hält mittlerweile sehr lange. Hersteller geben oft Lebensendekriterien von 1.000 bis 3.000 Zyklen an. "End of Life" bedeutet hier nicht, dass die Batterie tot ist, sondern dass ihre Speicherkapazität auf 80% des ursprünglichen Wertes gesunken ist.
Bei einer grossen Batterie mit 400 bis 500 km Reichweite pro Ladung können das 400.000 bis 500.000 Kilometer sein, bevor sie die 80%-Marke erreicht.
Auch danach kann die Batterie oft noch als sogenannte Second-Life-Batterie eingesetzt werden, beispielsweise in Speicherparks an Wind- oder Solarparks, wo sie noch 10 bis 15 Jahre weiterarbeiten kann.
Materialien und Rohstoffe:
Das Argument der "kritischen Rohstoffe" wird oft als Gegenargument zur Nachhaltigkeit verwendet. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass "kritisch" ein wissenschaftlich-politischer Begriff ist, der nicht nur die Seltenheit eines Rohstoffs, sondern auch unsichere Lieferketten oder politische Abhängigkeiten (z.B. bei Graphit und Magnesium, deren Hauptlieferant China ist) umfasst.
Die Forschung und Entwicklung zielt darauf ab, eine geostrategische Unabhängigkeit zu erreichen, indem Batterien mit lokal verfügbaren Ressourcen hergestellt werden können. Dies führt dazu, dass seltene oder kritische Rohstoffe zunehmend aus der Batterie verdrängt werden.
Wichtig ist auch die Klarstellung: In Lithium-Ionen-Batterien gibt es keine seltenen Erden. Dieser Mythos basiert auf einer Verwechslung mit Nickel-Metallhydrid-Batterien.
Die Nachhaltigkeit von Lithium-Ionen-Batterien und Elektroautos bereits heute deutlich besser ist als oft angenommen und sich durch technologische Fortschritte und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Produktion stetig verbessert.
O wie „Oje, Batterie-Rohstoffe“ (Kobalt, Lithium, Nickel, Graphit) – Warum werden diese Rohstoffe als „kritisch“ bezeichnet?
Das Wort "kritisch" in Bezug auf Batterierohstoffe lässt viele Menschen aufhorchen und skeptisch werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass "kritisch" ein wissenschaftlich-politischer Begriff ist, der über die blosse Seltenheit eines Rohstoffs hinausgeht und mehrere Aspekte umfasst:
Seltenheit und Verfügbarkeit:
Ein Rohstoff wird als kritisch eingestuft, wenn er sehr selten ist und befürchtet wird, dass er zur Neige gehen könnte.
Unsichere Versorgungsketten:
Wenn die Lieferketten für einen bestimmten Rohstoff unsicher oder instabil sind, kann dies ebenfalls zu seiner Einstufung als kritisch führen.
Politische Abhängigkeiten:
Dies ist ein besonders wichtiger Aspekt. Rohstoffe gelten als kritisch, wenn sie aus Ländern stammen, bei denen es politische Bedenken gibt oder die bereit sein könnten, den Rohstoff als Machtinstrument einzusetzen.
Beispiele für kritische Rohstoffe in Batterien:
Kobalt:
Kobalt ist ein kritischer Rohstoff, da es unter anderem aus dem Kongo stammt und nicht in riesigen Mengen auf der Erde vorkommt.
Magnesium und Graphit:
Auch Materialien wie Magnesium und Graphit (welches man auch in Bleistiften findet) gelten als kritisch. Der Hauptlieferant für diese Stoffe ist China. Die internationale Gemeinschaft, wie zum Beispiel die EU, betrachtet es als kritisch, wenn es nur einen Hauptlieferanten gibt, der potenziell bereit ist, den Rohstoff als politisches Machtinstrument zu nutzen.
Das Ziel: Geostrategische Unabhängigkeit.
Genau aus diesen Gründen gibt es viel Forschung und Entwicklung, beispielsweise in Initiativen wie dem "Exzellenzcluster". Das übergeordnete Ziel ist es, eine geostrategische Unabhängigkeit zu erreichen. Dies bedeutet, Batterien bauen zu können, die idealerweise mit lokal verfügbaren Ressourcen hergestellt werden können. So soll die Abhängigkeit von Lieferketten, die für Machtspielchen missbraucht werden könnten, reduziert werden.
Ein wichtiger Hinweis zu "seltenen Erden":
Es ist ein hartnäckiger Mythos, dass Lithium-Ionen-Batterien "seltene Erden" enthalten. Dieser Mythos beruht auf einer Verwechslung: Seltene Erden (eine Substanzklasse seltener Metalle wie Lanthan oder Cer) sind zwar in Nickel-Metallhydrid-Batterien (dort im Minuspol als Legierung aus Lanthan und Nickel) zu finden, aber nicht in Lithium-Ionen-Batterien. Der Satz "Es gibt seltene Erden in der Batterie" ist im allgemeinen Sinne (als Überbegriff für Batterien) korrekt, aber der Satz "Es gibt seltene Erden in der Lithium-Ionen-Batterie" ist falsch.
Die Forschung arbeitet intensiv daran, seltene oder kritische Rohstoffe zunehmend aus Batterien zu verdrängen und so die Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Batterietechnologie weiter zu verbessern.
P wie Preise – Wieviel kostet eine Batteriezelle pro kWh derzeit?
Die Kosten für Batterien waren lange Zeit der grösste Preistreiber bei Elektroautos. Doch dieser Trend hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert und sorgt für eine zunehmende Wettbewerbsfähigkeit von E-Fahrzeugen.
Der aktuelle Stand der Kostenentwicklung:
Im letzten Jahr sind die Kosten für Batteriezellen noch einmal um 30% gesunken.
Mittlerweile kostet eine Batteriezelle je nach Ausführung zwischen knapp 50 $ pro Kilowattstunde und 60 $ pro Kilowattstunde.
Ein komplettes Batteriepack ist bereits für 60 $ bis 110 $ pro Kilowattstunde erhältlich.
Die Bedeutung dieser Preisentwicklung:
Diese Zahlen sind besonders interessant, weil man früher immer gesagt hat, dass Elektroautos billiger werden können als Verbrenner, sobald der Preis für das Batteriepack unter 100 $ pro Kilowattstunde fällt. Eine grosse Traktionsbatterie für ein Elektroauto kostet heute in der Herstellung noch etwa 5.000 bis 10.000 Euro.
Die kontinuierlich sinkenden Batteriepreise sind ein entscheidender Faktor, der die Elektromobilität immer erschwinglicher macht und somit einen wichtigen Beitrag zur breiteren Akzeptanz und Verbreitung von Elektrofahrzeugen leistet.
R wie Recycling – (Wie gut) Kann man Lithium-Batterien recyceln?
Das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien ist ein entscheidender Faktor für ihre Nachhaltigkeit und die zukünftige Kreislaufwirtschaft. Es gibt bereits etablierte Verfahren und innovative neue Ansätze, die das Recycling immer effizienter machen.
Zwei Hauptansätze im Batterierecycling:
Das klassische Recycling (Pyrometallurgie):
Dieses Verfahren wird beispielsweise von Firmen wie Umicore angewendet, die in Belgien einen grossen Schmelzofen betreiben.
Prozess:
Batterien jeglicher Art werden geschreddert, in den Ofen gegeben und eingeschmolzen. Unten erhält man einen Block aus geschmolzenem Metall, der Kobalt, Nickel und Eisen enthält. Lithium und Aluminium finden sich in der Schlacke.
Vorteile:
Dieses Verfahren ist kostengünstig und trägt sich finanziell selbst.
Nachteile:
Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Materialien am Ende als elementare Metalle vorliegen. Um daraus wieder neue, komplizierte Batterieverbindungen herzustellen, ist ein hoher chemischer Aufwand nötig.
Die neueren Verfahren (oft hydrometallurgisch oder direktes Recycling):
Dies ist der Ansatz, den viele neue Startups wie to Zero, Sip oder Düsenfeld erfolgreich verfolgen.
Prozess:
Bei diesen Verfahren wird die Batterie zunächst geöffnet und die einzelnen Batteriezellen werden entnommen. Die Elektroden – also die Speicherschichten, über die wir bereits bei "K wie Kathode und Anode" gesprochen haben – werden dann abgestreift und gesammelt oder geschreddert und abgelöst. Diese Speicherschichten werden anschliessend an Chemiefirmen geliefert, die sie aufbereiten und gewissermassen "frisch machen", damit daraus direkt wieder neue Batterien hergestellt werden können.
Vorteile:
Der grosse Vorteil dieser Methoden ist, dass die komplizierten Verbindungen der aktiven Materialien erhalten bleiben oder wiederhergestellt werden, was den Herstellungsprozess neuer Batterien vereinfacht und energieeffizienter macht. Es wird angestrebt, die gewonnenen Materialien möglichst direkt wieder in der Batterieproduktion einzusetzen.
Die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich schreitet schnell voran, um möglichst viele wertvolle Rohstoffe aus Altbatterien zurückzugewinnen und so den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft für Batterietechnologien.
S wie „Seltene Erden“ – Welche „Seltenen Erden“ befinden sich in Batterien?
Der Begriff "Seltene Erden" geistert immer wieder durch die Medien und wird oft fälschlicherweise im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien genannt. Es ist Zeit, diesen Mythos aufzuklären!
Was sind "Seltene Erden"?
„Seltene Erden“ ist eine Substanzklasse, die wirklich seltene Metalle wie Lanthan oder Cer umfasst. Der hartnäckige Mythos, dass diese in Lithium-Ionen-Batterien zu finden sind, beruht oft auf einer Verwechslung oder absichtlicher Framing.
Wo findet man Seltene Erden in Batterien?
Tatsächlich gibt es seltene Erden in Batterien – aber nicht in Lithium-Ionen-Batterien. Sie finden sich in:
Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH):
Dort ist der Minuspol (die Anode) eine Legierung aus Lanthan und Nickel. Diese Batterien wurden und werden beispielsweise in älteren Hybridfahrzeugen oder in bestimmten wiederaufladbaren Haushaltsbatterien verwendet.
Die entscheidende Unterscheidung:
Es ist wichtig zu betonen: Der Satz „Es gibt seltene Erden in der Batterie“ ist korrekt, wenn man von Batterien im allgemeinen Sinne spricht, also als Überbegriff für alle Batterietypen. Der Satz „Es gibt seltene Erden in der Lithium-Ionen-Batterie“ ist jedoch falsch.
Dieser Unterschied ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und eine sachliche Diskussion über die Rohstoffe von Batterien zu führen.
T wie "Batterie-Tipps" – Wie sollte ich meine Batterie behandeln, damit sie möglichst lange lebt?
Diese Frage ist eine der häufigsten, wenn es um Elektroautos geht. Die gute Nachricht vorab: Sie müssen sich generell keine grossen Sorgen machen! Die Batterien sind heutzutage extrem ausgereift und intelligent.
Das Wichtigste zuerst: Vertrauen Sie dem Batteriemanagementsystem!
- Die moderne Lithium-Ionen-Batterie eines E-Autos ist mit einem hochkomplexen Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet.
- Dieses System ist dafür zuständig, die Batterie so zu steuern, dass sie keinen Schaden nimmt. Es überwacht Temperatur, Ladezustand, Stromflüsse und vieles mehr.
- Die Sorge um die optimale Behandlung der Batterie können Sie also grösstenteils an dieses System abgeben. Es sorgt dafür, dass die Batterie durch Ihre Fahrweise kein Leid geschieht.
Allgemeine Hinweise und überraschende Details:
Nicht zu sehr stressen: Allgemein gilt, dass man die Batterie – ähnlich wie einen menschlichen Körper – nicht zu sehr stressen sollte. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Fahrweise extrem anpassen müssen.
Ruppiges Fahren kann sogar gut sein? Es gibt Hinweise darauf, dass sogar ein "ruppiges Fahren" der Batterie eher gut tun kann. Dies mag überraschend klingen, deutet aber darauf hin, dass die Systeme so konzipiert sind, dass sie auch dynamische Beanspruchungen gut verkraften.
Langlebigkeit ist Standard:
Wenn Sie ein E-Auto von einem guten Hersteller haben, können Sie damit "x-hunderttausende Kilometer fahren" und Ihren Spass dabei haben. Die Batterien sind für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt.
Kurz gesagt:
Die modernen Lithium-Ionen-Batterien sind so robust und intelligent konstruiert, dass Sie als Nutzer kaum etwas falsch machen können. Das integrierte Batteriemanagementsystem kümmert sich um die Gesundheit Ihrer Batterie, sodass Sie die Fahrt einfach geniessen können.
U wie "Batterie-Unternehmen" – Welche Batterieunternehmen aus Asien halten Sie als am erfolgreichsten?
Der Markt für Batterien, insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien, ist hart umkämpft. Die asiatischen Unternehmen spielen dabei eine führende Rolle und prägen die Entwicklung durch Innovation und Produktionskapazitäten. Es gibt dabei einen "ganzen Zoo von Firmen".
Der aktuelle Markt und die wichtigsten Akteure:
Im Augenblick herrscht ein "mörderischer Preiskampf" unter den Batterieunternehmen. Trotzdem zeichnen sich einige Firmen durch ihre Erfolge und Innovationen besonders aus:
BYD:
Dieses Unternehmen ist "klassischerweise eine Batterie Firma". Bereits in den 90er Jahren hat BYD Batterien hergestellt und sich von dort aus in die Automobilentwicklung ausgebreitet. BYD liefert sich ein "Kopf an Kopf Rennen" mit CATL.
CATL:
Dieses chinesische Unternehmen hat es geschafft, "wirklich zum Weltmarktführer zu werden". Dies gelang ihnen durch ein "konsequentes Reinvestment in Forschung und Entwicklung" und "sehr, sehr gute Ideen". CATL ist ebenfalls in einem intensiven Wettbewerb mit BYD.
Geely:
Obwohl Geely "wenig beachtet" wird, leistet dieses Unternehmen "fantastische Arbeiten". Geely hat kürzlich eine sogenannte "Short Blade Battery" auf den Markt gebracht, die durch ihre aussergewöhnliche Sicherheit besticht: Man kann darauf schiessen, sie durchstechen, biegen, zersägen oder heisses Wasser darüber giessen – es passiert nichts, und sie brennt nicht mehr. Geely ist damit "eine der ersten, die halt diese neue chinesische Regelung, dass da nichts mehr brennen darf in so einer Batterie, befolgen". Darüber hinaus gibt Geely an, dass ihre Batterien "1 Million Kilometer fahren" können, "ohne dass die Batterie Degradationserscheinungen zeigt", was als "absolut sensationell" bezeichnet wird.
Neben diesen grossen Namen gibt es auch Unternehmen wie Heiner, die an neuen Technologien wie Natrium-Ionen-Batterien arbeiten. Die Dynamik und Innovationskraft in diesem Sektor sind enorm, und es bleibt spannend zu beobachten, welche Unternehmen sich in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld zukünftig weiter abheben werden.
W wie "Wunderbatterien" – Noch immer sprechen einige Medien von "Superbatterien", gibt's die wirklich?
Der Begriff der "Wunderbatterie" oder des "Batteriedurchbruchs", bei dem eine einzige Zelle "alles kann", geistert immer wieder durch die Medien. Die Frage ist berechtigt: Stehen wir tatsächlich vor einem solchen revolutionären Sprung, oder ist es eher ein Mythos?
Die Realität: Evolution statt Revolution.
Die Forschung und Entwicklung im Bereich der Batterietechnologie zeigt, dass es keine plötzliche "Wunderbatterie" gibt, die über Nacht alle Probleme löst und in allen Eigenschaften gleichzeitig an die Spitze schiesst. Vielmehr ist die Batterietechnologie durch eine kontinuierliche Evolution gekennzeichnet.
Die Speicherkapazität von Batterien verbessert sich seit Jahren jährlich um etwa 6%. Dieser stetige Fortschritt ist für eine Technologie "der absolute Hammer" und lässt den Bedarf an einer singulären "Wunderbatterie" in den Hintergrund treten.
Was wir heute bereits an Batterieleistung sehen, wäre vor einigen Jahren noch als "Wunderbatterie" bezeichnet worden. Beispielsweise wurde bei der Gründung des Helmholtz-Instituts in Ulm ein Ziel von 110 Wattstunden pro Kilogramm angestrebt, was damals als "Wunderbatterie" gegolten hätte, aber mittlerweile "x mal überholt" wurde.
Beeindruckende Fortschritte, die nach "Wundern" klingen.
Ein Beispiel für solch beeindruckende Fortschritte, die fast an eine "Wunderbatterie" heranreichen, ist die "Short Blade Battery" von Geely, einem chinesischen Batterieunternehmen, das oft "wenig beachtet" wird.
Diese Batterie zeichnet sich durch eine aussergewöhnliche Sicherheit aus: Man kann auf sie schiessen, sie durchstechen, biegen, zersägen oder heisses Wasser darüber giessen – sie brennt nicht mehr und es passiert nichts. Sie erfüllt damit bereits neue chinesische Sicherheitsvorschriften, die besagen, dass Batterien nicht mehr brennen dürfen.
Darüber hinaus gibt Geely an, dass diese Batterien "1 Million Kilometer fahren" können, "ohne dass die Batterie Degradationserscheinungen zeigt". Dies wird als "absolut sensationell" bezeichnet.
Solche Entwicklungen zeigen, wie weit die Technologie gekommen ist. Sie sind jedoch das Ergebnis konsequenter Forschung, Entwicklung und Innovation in vielen kleinen Schritten und Sprüngen, nicht eines einzelnen, magischen Durchbruchs.
Herausforderungen und gegenläufige Eigenschaften.
Ein weiterer Grund, warum eine "Wunderbatterie", die alles perfekt kann, unwahrscheinlich ist, liegt in den gegenläufigen Eigenschaften von Batterien. Wichtige Parameter wie Speicherkapazität, Beladungsgeschwindigkeit, Preis, Sicherheit und Nachhaltigkeit stehen oft im Wettbewerb zueinander.
Wenn man beispielsweise eine sehr hohe Speicherkapazität erzielen möchte, muss man die Speicherschichten auf den Elektroden dick machen. Dies führt jedoch dazu, dass die Batterie langsamer lädt, da Lithium-Ionen und elektrischer Strom mehr Weg zurücklegen müssen.
Für Anwendungen wie Akkuschrauber, die schnell beladbar und entladbar sein müssen, werden daher sehr dünne Schichten verwendet, was die Speicherkapazität reduziert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwar keine einzelne "Wunderbatterie" erwarten sollten, die alle Parameter gleichermassen maximiert. Doch die Branche liefert durch stetige Innovationen und Optimierungen Batterien, die in vielen Bereichen bereits "Wunder" vollbringen und die Elektromobilität sowie die Energiewende massgeblich vorantreiben.
X wie "Explosion" – Wie oft explodieren Lithium-Batterien?
Der Anblick einer brennenden oder gar explodierenden Batterie, oft von E-Bikes oder anderen Kleingeräten, prägt sich schnell in unser Gedächtnis ein und schürt Ängste. Doch wie häufig sind solche Ereignisse wirklich bei Lithium-Batterien, insbesondere in E-Autos?
Die Wahrheit über die Häufigkeit von Explosionen.
Wie oft Batterien explodieren, ist schwer zu beziffern. Doch eines ist sicher: "man kann sich sicher sein dass wenn eine explodiert ist sie auf das Titelseite von der Bildzeitung". Das bedeutet, solche Vorfälle sind spektakulär genug, um sofort medial aufgegriffen zu werden, was einen falschen Eindruck von ihrer Häufigkeit vermitteln kann.
Sicherheit im Vergleich: E-Autos vs. Verbrenner.
Betrachtet man die Gesamtstatistik, so zeigt sich ein anderes Bild: Laut Zahlen amerikanischer Versicherer brannten Elektroautos vor einigen Jahren bereits etwa 30-mal seltener als Verbrenner pro gefahrene Kilometer und Zulassungszahlen. Diese Sicherheit wird sich sogar weiter verbessern.
Dank neuer Regelungen, die auch aus China kommen, dürfen Batterien schlichtweg nicht mehr brennen. Dies führt dazu, dass es immer weniger Gründe gibt, warum ein Fahrzeug überhaupt noch Feuer fangen kann.
Wenn zukünftig Festkörperbatterien zum Einsatz kommen, die keine brennbaren Flüssigkeiten mehr enthalten, wird die Sicherheit noch einmal auf ein neues Niveau gehoben.
Was steckt hinter den E-Bike-Bränden?
Die oft in den Medien gezeigten Brände von E-Bike-Akkus haben spezifische Ursachen:
- In E-Bikes werden häufig sogenannte Rundzellen verwendet, die man kaufen kann und die dann verlötet werden.
- Probleme entstehen, wenn Hersteller nicht sorgfältig arbeiten. Fährt man dann beispielsweise über eine "Rüttelpiste", können sich Verbindungen lösen und einen Kurzschluss verursachen.
- Der Rat ist klar: "kauft euch die Bikes bei einem Hersteller der wirklich ein gutes Renaume hat der die Sachen wirklich prüft und der Batterien verwendet die ist nicht von so einem chinesischen Noame Hersteller stammen".
Verhalten im Ernstfall.
Sollte ein Akku heiss werden oder brennen, gibt es einen wichtigen Sicherheitshinweis: Wenn in einer Anleitung steht, man solle ihn in einen Eimer Wasser stellen, ist das falsch und gefährlich. "Don't do it!". Die richtige Reaktion wäre, den brennenden Akku "raus in Garten legen oder sonst irgendwas aber aber aber aber nicht ins ins Wasser".
Batterieexplosionen und Brände, insbesondere bei modernen Elektroautos, kommen weit weniger häufig vor, als es der Eindruck in den Medien vermuten lässt. Die Technologie wird durch strenge Vorschriften und kontinuierliche Weiterentwicklung immer sicherer.
Z wie "Zyklen" – Wie langlebig sind denn die typischen Lithium-Batterien heutzutage?
Eine der häufigsten Fragen, die im Zusammenhang mit Elektroautos und Lithium-Ionen-Batterien gestellt wird, betrifft ihre Lebensdauer. Wie viele Lade- und Entladezyklen halten sie aus, und wie lange kann man ein Elektroauto wirklich fahren, bevor die Batterie schlappmacht?
Die Langlebigkeit moderner Lithium-Ionen-Batterien.
Im Allgemeinen gilt heutzutage der Grundsatz, dass typische Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen, je nach Hersteller, zwischen 1.000 und 2.000 Zyklen, manchmal sogar bis zu 3.000 Zyklen angeben, bis das sogenannte "End of Life" (EOL) erreicht ist.
Was bedeutet "End of Life" (EOL)? Es bedeutet nicht, dass die Batterie vollständig "tot" ist. Vielmehr wird als Lebensendekriterium definiert, dass die Batterie auf 80% ihrer ursprünglichen Speicherkapazität gefallen ist. Das bedeutet, sie hat immer noch eine erhebliche Restkapazität.
Umrechnung in Kilometer:
Eine grobe Überschlagsrechnung zeigt die beeindruckende Langlebigkeit: Wenn eine grosse Batterie, die beispielsweise 400 oder 500 km Reichweite pro Ladung ermöglicht, 1.000 Zyklen erreicht, bevor sie auf 80% ihrer Kapazität fällt, bedeutet das eine mögliche Fahrleistung von 400.000 bis 500.000 Kilometern. Das ist eine Distanz, bei der man wahrscheinlich schon lange ein anderes Fahrzeug fahren möchte.
Second Life: Ein zweites Leben für Batterien.
Auch nach Erreichen des "End of Life" im Fahrzeug haben Lithium-Ionen-Batterien oft noch einen erheblichen Wert und können weiter genutzt werden.
- Die Batterie kann danach noch als sogenannte "Second Life Batterie" verwendet werden.
- Sie finden dann ihren Einsatz beispielsweise in Speicherparks an Wind- oder Solarparks.
- Dort können sie dann oft noch einmal 10 bis 15 Jahre lang arbeiten.
Dies unterstreicht nicht nur die Robustheit der Batterien, sondern auch ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz.
Die Sorge um die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien in modernen Elektroautos ist weitestgehend unbegründet. Sie sind für eine sehr lange Nutzung konzipiert und bieten auch nach ihrem Einsatz im Fahrzeug noch wertvolle Speicherkapazität für andere Anwendungen.
Übersicht E-Autos.
E-Autos, Trends, Entwicklung, Technologien, Batterien, Märkte, Robotik, KI, FSD (autonomes Fahren), Ladezeit, Reichweite: Ausblicke in die dynamische Entwicklung des Elektroautomarktes: Technologien und globale Skalierung.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Mit bestem Dank für Video und deren Verwendung, an:
- Maximilian Fichtner
- das Team von Geladen Batteriepodcast
©Copyright Video und Texte: Geladen - Batteriepodcast zur Energiewende.