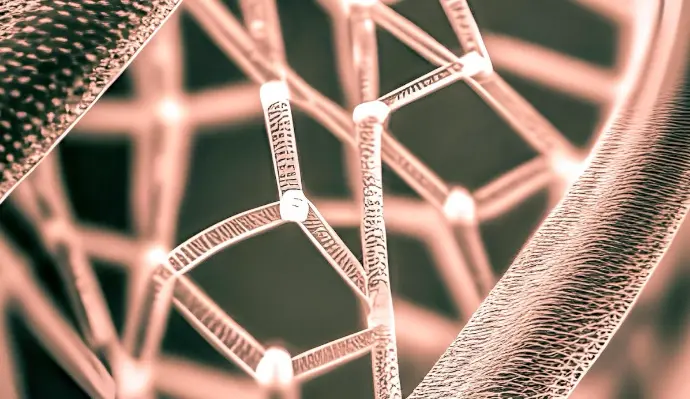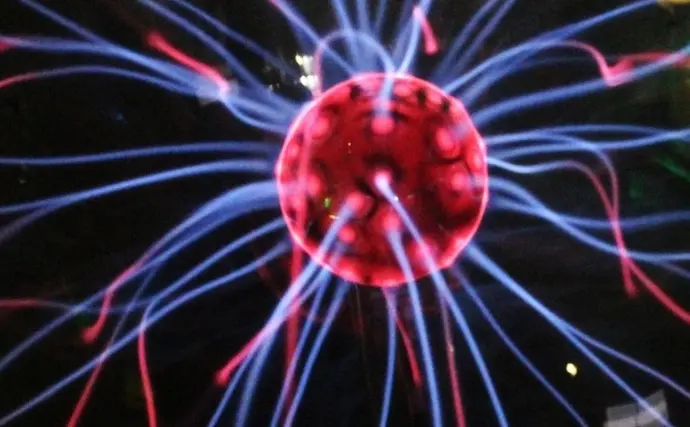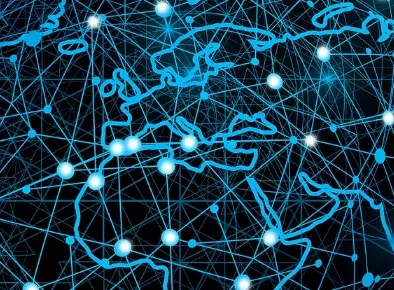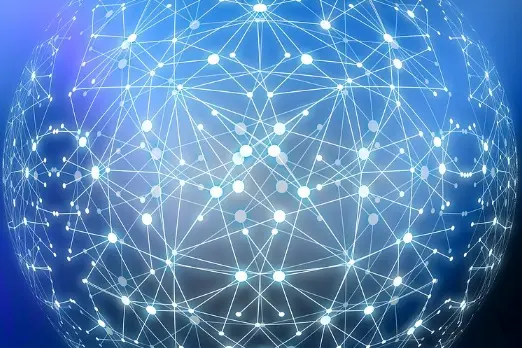Thermoelektrische Generatoren (TEG), thermoelektrische Kühler (TEC): Vorteile und Herausforderungen.
7.7.2025
Mehr und umfassende Informationen zu thermoelektrischen Generatoren (TEG) und thermoelektrischen Kühlern (TEC) finden Sie hier:
Thermoelektrische Generatoren (TEG).
Was sind die primären Vorteile und Herausforderungen aktueller thermoelektrischer Generatoren?
Thermoelektrische Generatoren (TEGs) wandeln Wärme direkt in elektrische Energie um, basierend auf dem Seebeck-Effekt. Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von der Stromversorgung entlegener Gebiete bis zur Nutzung von Abwärme in der Industrie und im Automobilbereich.
Funktionsweise:
TEGs nutzen den Seebeck-Effekt, bei dem ein Temperaturunterschied zwischen zwei
verschiedenen Halbleitermaterialien eine elektrische Spannung erzeugt. Durch
die Erwärmung einer Seite des Generators wandern Ladungsträger von der warmen
zur kalten Seite, was einen elektrischen Stromfluss erzeugt.
Mögliche Anwendungen:
Energieversorgung in abgelegenen Gebieten:
TEGs können als autarke Stromquellen in Regionen dienen, in denen keine Stromnetze verfügbar sind, z.B. in der Öl- und Gasindustrie zur Versorgung von Sensoren und Überwachungssystemen entlang von Pipelines.
Abwärmenutzung:
In vielen industriellen Prozessen geht ein grosser Teil der Energie als Abwärme verloren. TEGs können diese Abwärme nutzen, um Strom zu erzeugen und so den Energieverbrauch zu senken, z.B. in Heizungsanlagen, Geothermieanlagen oder der Automobilindustrie.
Sensoren und Messtechnik:
TEGs können in Sensoren und Messgeräten eingesetzt werden, die an schwer zugänglichen oder energieautarken Orten betrieben werden müssen.
Raumfahrt:
In der Raumfahrt werden TEGs, insbesondere mit radioaktiven Isotopen betrieben, um Strom zu erzeugen und Raumfahrzeuge mit Energie zu versorgen.
Wearables:
Es gibt auch Ansätze, TEGs zur Energiegewinnung aus Körperwärme zu nutzen, um tragbare elektronische Geräte mit Strom zu versorgen.
Vorteile:
Zuverlässigkeit:
TEGs sind wartungsarm und arbeiten ohne bewegliche Teile, was sie sehr zuverlässig macht.
Geräuscharm:
Der Betrieb von TEGs ist weitgehend geräuschlos.
Umweltfreundlich:
TEGs können zur Nutzung von Abwärme beitragen und so den Energieverbrauch und die Emissionen reduzieren.
Flexibilität:
TEGs können für verschiedene Leistungsbereiche eingesetzt werden und sind auch für kleine Leistungen gut geeignet.
Thermoelektrische Generatoren (TEGs) ermöglichen die direkte Umwandlung von Wärmeenergie in elektrische Energie und gelten als Schlüsseltechnologie zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Ihr wartungsfreier und geräuschloser Betrieb ohne bewegliche Teile macht sie für eine Vielzahl künftiger Märkte attraktiv. Die Aussichten für TEGs sind vielversprechend, bedingt durch kontinuierliche technologische Verbesserungen, wachsendes Bewusstsein für Energieeffizienz und ihre Integration in erneuerbare Energiesysteme.
Primäre Vorteile von Thermoelektrischen Generatoren:
Direkte Energieumwandlung und Effizienzsteigerung:
TEGs wandeln Wärme direkt in elektrische Energie um, basierend auf dem Seebeck-Effekt.
Sie tragen zur Steigerung der Energieeffizienz bei, indem sie ungenutzte Abwärme – die in industriellen Prozessen oft einen Grossteil der eingesetzten Energie ausmacht – in nutzbaren Strom umwandeln. Dies führt auch zu einer Reduzierung von Treibhausgasemissionen.
Robustheit und Betriebseigenschaften:
TEGs kommen ohne bewegliche Teile aus, was ihnen eine hohe Lebensdauer, geringe Wartungskosten und einen vibrations- und geräuschlosen Betrieb verleiht. In der Raumfahrt haben sie ihre Zuverlässigkeit über Jahrzehnte bewiesen.
Sie bieten die Möglichkeit einer autarken, batterielosen Stromversorgung für Sensoren und Geräte, insbesondere im Internet der Dinge (IoT).
Breites Spektrum an Anwendungsbereichen:
Industrielle Abwärmerückgewinnung: Es besteht ein erhebliches Potenzial, ungenutzte Abwärme aus Industrieprozessen zu nutzen, selbst im Niedertemperaturbereich. Containergrosse TEG-Einheiten sind bereits auf dem Markt. Besonders interessant sind Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) aufgrund langer Abschreibungszeiten und öffentlicher Förderung, mit einem Potenzial von 10 MW elektrischer Leistung allein in Schweizer KVAs.
Automobilindustrie: TEGs können Abwärme von Verbrennungsmotoren in Strom für die Bordelektronik umwandeln, den Kraftstoffverbrauch um geschätzte fünf bis zehn Prozent senken und den CO2-Ausstoss reduzieren. Der steigende Stromverbrauch der Bordelektronik macht ihren Einsatz immer sinnvoller.
Raumfahrt: TEGs werden in Radionuklidbatterien (RTGs) eingesetzt, um aus radioaktivem Zerfall zuverlässig Strom für Raumsonden und abgelegene Mess-Sonden zu erzeugen, wenn Solarzellen nicht nutzbar sind.
Internet der Dinge (IoT) und Sensorik: Sie ermöglichen den wartungsfreien, batterielosen Betrieb von Sensoren, Powermanagement und Funksensorik. Anwendungen finden sich im Monitoring von Rohrleitungen, in Gebäuden (z.B. Kühlhäuser, Bürogebäude, Serverräume) und in Wearables (Smartwatches, Fitnessarmbänder). Im Flugzeugbau reduzieren sie Gewicht und Komplexität durch kabellosen Sensorbetrieb für Structural Health Monitoring und Predictive Maintenance.
Geothermie: Einsatzmöglichkeiten bestehen bei extremen Temperaturgradienten, wie in Vulkanlandschaften.
Portable und Off-Grid-Anwendungen: In abgelegenen Gebieten können sie als Stromquellen für kleine Leistungen dienen, z.B. für Rundfunkempfänger durch Abwärme von Petroleumlampen oder Holzkohlegrills, oder für Wanderer aus Körperwärme oder Lagerfeuer.
Thermoelektrische Kühlung (Peltier-Effekt): Neben der Stromerzeugung können TEGs auch zur direkten Umwandlung von Strom in Kälte genutzt werden, ohne Kühlmittel oder komplexe mechanische Teile. Dies findet Anwendung in Präzisionskühlung von Infrarotkameras, Spezialkühlschränken und Computerkomponenten.
Fortschritte in Material und Fertigung:
Die Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung und Optimierung kostengünstiger, hochverfügbarer und nachhaltiger thermoelektrischer Materialien. Beispiele hierfür sind flexible Polymer-Oxid Verbundwerkstoffe und insbesondere Tellur-freie Magnesium-Antimon-Verbindungen, die bereits einen höheren Wirkungsgrad als kommerzielle Bismuttellurid-TEGs erreichen.
Neue, hochskalierbare Fertigungsverfahren wie Siebdruck und Origami-Faltung ermöglichen die kostengünstige, skalierbare Produktion von flexiblen und dreidimensionalen TEGs, die individuell an Anwendungen angepasst werden können. Flexible Designs verbessern den Oberflächenkontakt und somit die Effizienz erheblich.
Strategische Partnerschaften zwischen Industrie, Forschung und Technologieentwicklern sowie Regierungsinitiativen und Förderungen beschleunigen die Forschung, Entwicklung und Markteinführung.
Herausforderungen aktueller Thermoelektrischer Generatoren.
Geringer Wirkungsgrad:
Ein wesentlicher Nachteil ist der geringe Wirkungsgrad. Aktuelle TEGs erreichen oft nur 2 bis 7 Prozent, im Bestfall bis zu 17 Prozent, was lediglich einen Bruchteil des theoretisch möglichen Carnot-Wirkungsgrades darstellt. Dies macht sie im Vergleich zu traditionellen Wärme-Kraft-Maschinen weniger effizient.
Material- und Herstellungskosten:
Die derzeit eingesetzten Materialien sind in der Herstellung und Prozessierung oft sehr teuer und ökologisch nicht nachhaltig.
Insbesondere Bismuttellurid-Verbindungen, die lange die Grundlage für kommerziell genutzte TEGs bildeten, sind durch die Knappheit des Elements Tellur (unter 0,001 ppm in der Erdkruste, Produktion <500 t/Jahr) in ihrer grossflächigen Anwendung begrenzt. Obwohl Bleitellurid (PbTe) technisch geeignet wäre, ist Blei giftig und in elektrischen Komponenten nicht erlaubt.
Die hohen Materialkosten sind ein signifikanter Nachteil.
Wirtschaftlichkeit und Amortisationszeiten:
Für viele industrielle Abwärmeanwendungen ist die thermoelektrische Nutzung derzeit unwirtschaftlich, da die üblichen Amortisationszeiten in der Industrie von drei bis fünf Jahren mit TEGs aktuell nicht erreicht werden können.
Die Rentabilität industrieller Anwendungen wäre oft erst bei deutlich höheren Strompreisen gegeben. Bei der Nutzung von Abwärme aus industriellen Kühlwässern sind TEGs für On-Grid-Anwendungen bis auf Weiteres keine wirtschaftliche Lösung.
Anforderung an Temperaturdifferenz und Materialeigenschaften:
TEGs benötigen eine signifikante Temperaturdifferenz zwischen der warmen und kalten Seite, um effizient Strom zu erzeugen. Um brauchbare Spannungen und Leistungen zu erreichen, müssen oft Hunderte oder Tausende von Elementen in Reihe oder parallel geschaltet werden.
Die Entwicklung geeigneter Materialien ist herausfordernd, da diese gleichzeitig eine hohe elektrische Leitfähigkeit und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen müssen – eine paradoxe Anforderung, die es in der Materialforschung zu überwinden gilt.
Bestimmte Standardmaterialien wie Bismuttellurid sind nicht für hohe Temperaturen, wie sie beispielsweise im Autoauspuff vorkommen, geeignet, da sie bei diesen Temperaturen schmelzen würden.
Herausforderungen in Design und Integration:
Traditionelle TEGs haben oft eine quadratische Form, was die Anpassung an vielfältige wärmeerzeugende Geräte wie Rohre und Auspuffanlagen erschwert. Obwohl flexible Lösungen entwickelt werden, bleibt die optimale Anpassung und Integration eine technische Herausforderung.
Grössere TEGs können unter einer geringeren Energiedichte und Leistung leiden, obwohl flexible Designs mit Flüssigmetall hier Abhilfe schaffen können.
Das Packaging der TEG-Elemente muss sowohl resistent gegenüber Umwelteinflüssen als auch wärmeleitfähig sein, wobei die Temperaturwechselbeständigkeit (Starrheit und Sprödigkeit) eine Rolle spielt.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.