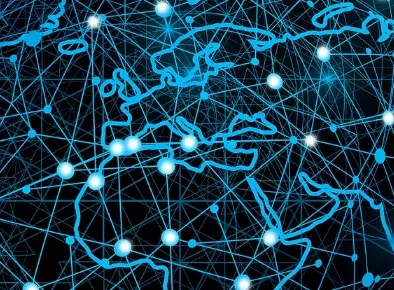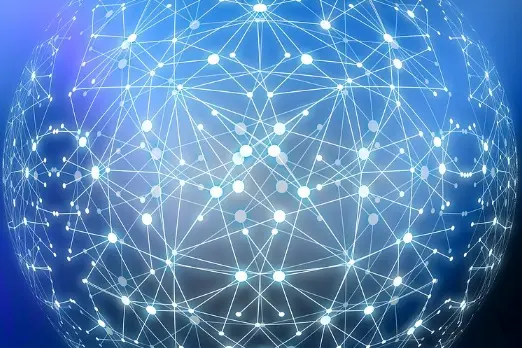Werden die Klimaziele bis 2045 zur vollständigen Elektrifizierung des Strassengüterverkehrs erreicht?
5.9.2025
Der Strassengüterverkehr muss zur Erreichung der Klimaziele bis 2045 vollständig elektrifiziert werden, was einen sehr steilen Markthochlauf erfordert. Die Treibhausgas-Emissionen dieses Sektors sind in den letzten 30 Jahren um 30 % gestiegen.
Können die Klimaziele bis 2045 erreicht werden?
Dominanz batterieelektrischer LKW (BEV): In allen untersuchten Szenarien werden BEV den zukünftigen Transportmarkt prägen. Brennstoffzellen-LKW (FCEV) und Oberleitungs-LKW (O-BEV) zeigen geringere Potenziale.
Wichtigste Hebel für den Markthochlauf: Die beiden entscheidenden Instrumente sind eine CO2-basierte Lkw-Maut und die Verfügbarkeit öffentlicher Ladeinfrastruktur. Eine ambitionierte Umsetzung der Eurovignetten-Richtlinie sichert den Kostenvorteil emissionsfreier Antriebe bereits um das Jahr 2030.
Enormer Infrastrukturbedarf: Für die Elektrifizierung ist ein massiver und schneller Aufbau von Energie-Infrastrukturen notwendig. Depotladen bildet mit einem geschätzten Anteil von 55 % des Energiebedarfs den Kern der Energieversorgung. Für den Fernverkehr ist der Aufbau eines flächendeckenden Megawatt-Charging-Systems (MCS) der entscheidende Schlüssel.
Zeitdruck und Planungssicherheit: Der Aufbau, insbesondere von MCS-Ladepunkten mit Anschluss an das Hochspannungsnetz, ist zeitintensiv (bis zu 10 Jahre) und erfordert eine frühzeitige, zielgerichtete Planung.
Technologiepfade im Vergleich.
Rein batterieelektrische LKW:
Dieser Pfad ist in allen Szenarien dominant. Der Hochlauf hängt massgeblich von der Ausbaurate der öffentlichen Ladeinfrastruktur ab. Steht bis 2035 ein flächendeckendes Ladenetz zur Verfügung, erreichen batterieelektrische LKW bereits 2030 einen Neuzulassungsanteil von 55 %.
Kombination aus batterieelektrische LKW und Brennstoffzellen-LKW (Wasserstoff):
Brennstoffzellen-LKW können nur bei sehr optimistischen Preisannahmen für grünen Wasserstoff (ca. 5,70 €/kg) in Kombination mit hohen Ladestrompreisen signifikante Marktanteile erreichen. Der hohe Energieverbrauch und Unsicherheiten bei der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff begrenzen ihr Potenzial.
Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership - TCO).
Die TCO sind das zentrale Kriterium für die Kaufentscheidung.
Heutige Situation: Ohne Förderinstrumente sind E-LKW aktuell teurer. Die Lkw-Maut ist der entscheidende Hebel, um einen Kostenvorteil zu schaffen. Eine ambitionierte Ausgestaltung (z.B. 200 €/t CO2-Aufschlag und 75 % Rabatt für Nullemissionsfahrzeuge) macht BEV robust kostengünstiger als Diesel-LKW.
Kostenbestandteile:
Anschaffungskosten: Bleiben auch 2030 für BEV deutlich höher (je nach Batteriegrösse 30-55 % Aufpreis gegenüber Diesel).
Energiekosten: BEV haben einen Effizienzvorteil von ca. 50 % gegenüber Diesel-LKW. FCEV sind mit ca. 15 % Einsparung deutlich weniger effizient.
Wartungskosten: Sind für elektrische Antriebe um rund ein Viertel geringer.
Bedarf an Energie-Infrastruktur.
Der Aufbau der Infrastruktur ist die grösste Herausforderung. Die Studie prognostiziert für das Szenario eines flächendeckenden Netzes bis 2035 folgende Bedarfe für Deutschland:
Rund 90.000 betriebliche Depot-Ladepunkte (DCS).
Rund 40.000 öffentliche Nachtladepunkte (NCS) mit bis zu 150 kW an Rastanlagen.
Rund 2.000 öffentliche Megawatt-Charging-System (MCS)-Ladepunkte mit über 1 MW Leistung, hauptsächlich entlang der Autobahnen.
Die benötigten Ladeleistungen an verkehrsstarken Autobahn-Hubs erfordern einen Anschluss an das Hochspannungsnetz, was die Planung sehr zeitkritisch macht.
Die Investitionsbedarfe für die öffentliche Infrastruktur bis 2045 werden für den reinen BEV-Pfad auf 5 bis 10 Mrd. Euro geschätzt. Die Mix-Szenarien mit FCEV oder O-BEV sind teurer.
Auswirkungen auf den Markt und die Klimaziele.
Markthochlauf: In einem ambitionierten Szenario ("recharge2035") liegt der Bestandsanteil von BEV im Jahr 2030 bei 16 % und steigt bis 2035 auf 48 %. Das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 ein Drittel der Fahrleistung elektrisch zu erbringen, wird in diesem Szenario knapp verfehlt, aber bereits 2031 erreicht.
Treibhausgas-Emissionen: Der Wechsel auf elektrische Antriebe ist der Haupttreiber zur Senkung der Emissionen. Der Aufbau der Ladeinfrastruktur hat den grössten Einfluss auf die Geschwindigkeit der Emissionsminderung. Selbst im schnellsten Szenario verbleibt 2030 eine Lücke zum Klimaschutzziel.
Nationale vs. EU-Ziele: Die nationalen Klimaziele erfordern Ambitionen, die deutlich über die Mindestvorgaben der EU (z.B. im Rahmen der AFIR-Verordnung zum Infrastrukturaufbau) hinausgehen. Die Bedarfe an Ladeinfrastruktur in Deutschland übersteigen die EU-Vorgaben bereits 2030 um das Doppelte und 2035 um den Faktor acht.
Zukunft von Batterien in Elektro-Lastkraftwagen (E-LKW).
Der "Geladen - Batteriepodcast zur Energiewende" beleuchtet die Entwicklung und Zukunft von Batterien in Elektro-Lastkraftwagen (E-LKW). Markus Erdmann von Designwerk erläutert die wirtschaftlichen und technischen Aspekte dieser Technologie, einschliesslich der sinkenden Gesamtbetriebskosten von E-LKWs, die bis 2030 sogar die Anschaffungskosten von Diesel-LKW erreichen könnten. Ein zentraler Punkt ist die Verschiebung von NMC- zu LFP-Batterien, wobei letztere aufgrund ihrer Preisentwicklung und der erwarteten Leistungssteigerung durch LMFP-Varianten zunehmend an Bedeutung gewinnen. Des Weiteren werden Ladeinfrastrukturen wie Megawatt Charging (MCS) und Batteriewechselsysteme als Lösungen für Reichweite und schnelle Betankung vorgestellt, wobei MCS als die dominierende Technologie für die breite Masse angesehen wird und Batteriewechselsysteme eher für spezialisierte Anwendungen. Die Diskussion umfasst auch die Platzierung und das Gewicht der Batteriepakete sowie die Standardisierung von Zellformaten in der LKW-Industrie.
Kernaussagen und wichtigste Prognosen der PWC Studie.
Die Studie prognostiziert eine rasante Beschleunigung der Elektrotransformation im Lkw- und Bus-Verkehr, die vor 2030 einen Wendepunkt erreichen wird. Logistiker, die frühzeitig auf Elektromobilität umstellen, können von enormen Wettbewerbsvorteilen profitieren.
Marktanteil und Produktionsvolumen:
Im Jahr 2030 werden voraussichtlich mehr als 20 % aller weltweiten Lkw und Busse batterieelektrisch angetrieben sein.
Bis 2040 soll dieser Anteil bereits bei 90 % liegen.
Das jährliche Produktionsvolumen in den drei grössten Märkten (Nordamerika, Europa, Grosschina) wird von ca. 600.000 E-Lkw (BET) im Jahr 2030 auf über 2,7 Millionen im Jahr 2040 ansteigen.
Gesamtbetriebskosten (TCO):
E-Lkw werden spätestens ab 2030 trotz höherer Anschaffungspreise bei den TCO die Verbrenner schlagen.
Ein Experte aus der Branche widerspricht dieser Prognose teilweise und gibt an, dass je nach Markt und Einsatzprofil die TCO-Gleichwertigkeit heute schon erreicht ist, insbesondere bei hohen Jahresfahrleistungen. Er geht sogar davon aus, dass bis 2030 keine Fördermassnahmen mehr nötig sein werden, um diesen Zustand zu halten und prognostiziert eine Parität bei den reinen Anschaffungspreisen bis 2030.
Klimaschutz:
Der Umstieg auf E-Lkw stellt einen erheblichen Hebel für den Klimaschutz dar. Ein elektrifizierter Lkw spart im Durchschnitt mehr als 20-mal so viel CO₂ ein wie ein elektrisch angetriebener Pkw.
Treiber der Transformation.
Die Transformation wird vor allem durch drei Faktoren angetrieben: technologische Fortschritte, sinkende Gesamtbetriebskosten (TCO) und eine strengere Regulatorik.
Regulatorik: Die Vorschriften ziehen insbesondere in Europa stark an. OEMs müssen ihre Lkw-Emissionen bis 2030 um 45 % und bis 2040 um 90 % reduzieren (im Vergleich zum Referenzjahr). Zusätzlich werden bis 2030 in Europa punktuelle, urbane Fahrverbote für konventionelle Lkw erwartet.
Technologische Fortschritte (Prognose bis 2030):
- Reichweite: Ein Sprung um ca. 50 % von 600 auf 900 Kilometer. Dies wird E-Lkw für den Fernverkehr und für Linienverbindungen zwischen Logistik-Hubs wirtschaftlich sinnvoll machen. Ein Praktiker hält Reichweiten von 600-700 km im Realbetrieb schon heute für ausreichend, um einen guten Teil des Marktes abzudecken und erwartet für 2030 Reichweiten von 700-800 km.
- Ladegeschwindigkeit: Eine Erhöhung um 200 % auf bis zu 1.200 kW.
- Kosten: Die Kosten für BET-Antriebsstränge werden um etwa 10 % sinken.
- Batteriemarkt: Der wachsende E-Lkw-Markt wirkt sich stark auf den globalen Batteriemarkt aus. 2030 werden bereits 13 % (ca. 450 GWh) der gesamten Batteriekapazität von Fahrzeugen in E-Lkw verbaut; 2035 wird der Anteil doppelt so hoch sein.
Schlüsselrolle der Ladeinfrastruktur.
Die Ladeinfrastruktur ist der entscheidende Faktor für den Durchbruch, da Energiekosten einen Grossteil der TCO ausmachen. Der TCO-Vorteil von E-Lkw wird hauptsächlich durch die geringeren Energiekosten erzielt, was jedoch günstige und schnelle Ladepunkte voraussetzt.
Fokus auf Depotladen:
Das Depotladen wird als Schlüssel für die Transformation gesehen, um die Ladekosten kontrollieren und die Planungssicherheit zu verbessern. Die Logistikbranche sollte hier selbst die Initiative ergreifen und verstärkt investieren.
Öffentliche Schnellladeparks sind zwar für die Flächenabdeckung notwendig, unterliegen aber in ihrer Auslastung grosser Volatilität.
Investitionsbedarf in Europa (bis 2035):
Der private Sektor (Logistikbranche) müsste 28,6 Mrd. Euro für ca. 28.500 Depot-Ladepunkte aufbringen.
Der öffentliche Investitionsbedarf für 720 Ladeparks zur Gewährleistung einer flächendeckenden Infrastruktur liegt bei 6,1 Mrd. Euro.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie von Strategy& einen tiefgreifenden und sich beschleunigenden Wandel hin zur Elektromobilität im Lkw-Verkehr prognostiziert, der massgeblich von den Gesamtbetriebskosten und dem Ausbau der (Depot-)Ladeinfrastruktur abhängt.

Einschätzung des Marktes für batterieelektrische Lastkraftwagen (E-LKW) gemäss „Geladen - Batteriepodcast zur Energiewende“:
Markus Erdmann von Designwerk stellt fest, dass die Stimmung in der Logistikbranche je nach Land sehr unterschiedlich ist:
Schweiz und Norwegen:
Hier herrscht grosser Optimismus. In der Schweiz, dem Sitz von Designwerk, haben einige Firmen angekündigt, bis 2030 bereits 60-80 % ihres Fuhrparks zu elektrifizieren. Beide Länder führen in Europa mit Zulassungszahlen von etwa 12 % für batterieelektrische LKW in der schweren Klasse.
Deutschland:
Der Markt ist nach dem Wegfall der staatlichen Förderung deutlich verunsicherter und kam kurzzeitig fast zum Erliegen. Mittlerweile erholt er sich langsam wieder, angetrieben von grossen Flottenkunden, die die Notwendigkeit der Umstellung erkennen. Erdmann sieht dies jedoch nur als temporäre Delle und erwartet, dass der Wachstumstrend anhält, da die Batterien und Fahrzeuge günstiger werden.
Gesamtbetriebskosten (TCO) und Anschaffungspreise.
Ein entscheidender Faktor für die Transformation ist die Wirtschaftlichkeit der E-LKW im Vergleich zu Dieselfahrzeugen.
Aktuelle Situation:
Entgegen der Prognose, dass E-LKW erst ab 2030 bei den Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) günstiger sein werden, stellt Erdmann klar, dass dies je nach Markt und Einsatzprofil schon heute der Fall ist. Besonders im Fernverkehr mit hohen jährlichen Kilometerleistungen (100.000 bis 200.000 km) sind E-LKW bereits heute TCO-seitig sehr attraktiv, selbst ohne Fördermassnahmen.
Schlüsselrolle Depotladen:
Das Laden auf dem eigenen Betriebshof ("Depotladen") ist das Mittel der Wahl für Flottenkunden, da es Kontrolle über die Strompreise ermöglicht und die Integration erneuerbarer Energien (z.B. Solar in Kombination mit Batteriespeichern) erlaubt.
Prognose bis 2030:
Erdmann geht davon aus, dass bis 2030 keine Fördermassnahmen mehr nötig sein werden, um die TCO-Gleichwertigkeit zu erhalten. Er prognostiziert sogar, dass durch sinkende Batteriekosten und Skaleneffekte bei der Produktion von E-Fahrzeugen eine Parität bei den Anschaffungspreisen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen erreicht werden könnte. Gleichzeitig rechnet er mit steigenden Kosten für Diesel-LKW durch Massnahmen wie die Euro-7-Norm und CO2-Abgaben.
Reichweite und Batterietechnologie.
Aktuelle Reichweiten:
Die grössten Fahrzeuge von Designwerk haben eine Batteriekapazität von über 1.000 kWh und erreichen damit eine reale Reichweite von 650 bis 700 Kilometern bei voller Beladung. Dies deckt bereits einen grossen Teil des Marktes ab, insbesondere wenn in den gesetzlichen Fahrerpausen nachgeladen wird.
Zukünftige Entwicklung:
Erdmann erwartet, dass sich die Reichweiten bis 2030 bei etwa 700 bis 800 Kilometern einpendeln werden. Der Fokus werde sich dann eher darauf verlagern, die Fahrzeuge günstiger und leichter zu machen, anstatt die Reichweite weiter zu maximieren.
Batteriepacks:
Designwerk verbaut Batteriepacks mit Kapazitäten von 65 kWh bis zu 254 kWh und arbeitet an einer neuen Generation mit 340 kWh. Diese grossen Packs werden gebaut, um eine hohe Energiedichte zu erreichen. Ein solcher Batterieblock wiegt zwischen 1,2 und 1,4 Tonnen. Die Packs werden typischerweise zwischen der ersten und zweiten Achse oder, bei speziellen Fahrzeugen wie Betonmischern, hinter der Fahrerkabine montiert.
Ladeinfrastruktur: Megawatt-Charging vs. Batteriewechsel.
Zwei zentrale Technologien stehen für das "Tanken" von E-LKW im Fokus.
Megawatt-Charging (MCS).
Technologie:
MCS ist der neue Schnellladestandard für LKW, der Ladeleistungen von über 2 bis knapp 3 Megawatt ermöglicht. Damit ist nicht mehr der Stecker, sondern die Batterie selbst das limitierende Element.
Praktischer Nutzen:
Ziel ist es, in einer 45-minütigen Fahrerpause ausreichend Reichweite nachzuladen, um den restlichen Tag zu bewältigen. Konkret sollen die Fahrzeuge von Designwerk in etwa einer halben Stunde 500 km reale Reichweite nachladen können.
Infrastruktur:
Erdmann schätzt, dass es in Deutschland aktuell etwa 50 LKW-taugliche Ladeparks gibt, von denen aber noch keiner MCS-fähig ist. Der MCS-Standard befindet sich noch in der finalen Standardisierungsphase, und der Ausbau wird in den nächsten ein bis zwei Jahren erwartet.
Netzstabilität:
Das Argument, MCS würde die Stromnetze destabilisieren, entkräftet Erdmann. Die Lösung sind grosse Batteriespeicher an den Ladeparks, die Leistungsspitzen abfedern, die Integration erneuerbarer Energien ermöglichen und die Leistungskosten senken. Designwerk hat hierfür eine eigene Lösung in Form eines Schiffscontainers mit Batterien und 2-MW-Ladesäulen entwickelt, der mit einem geringen Netzanschluss auskommt.
Batteriewechsel (Battery Swapping).
Erfahrung:
Designwerk betreibt in einem Forschungsprojekt mit der TU Berlin die einzigen zwei LKW mit Batteriewechselsystem in Europa. Eine Wechselstation steht bei Berlin, an der bereits fast 1.000 fehlerfreie Wechselvorgänge durchgeführt wurden.
Ablauf:
Zwei grosse Batterieblöcke zwischen den Achsen können automatisiert aus dem Fahrzeug gehoben werden. Der gesamte Vorgang dauert nur acht bis zehn Minuten, mit Potenzial für weitere Optimierung.
Herausforderungen:
Die grösste Hürde für eine flächendeckende Einführung ist die fehlende Standardisierung der Batteriepacks, da jeder LKW-Typ (z.B. Fernverkehrs-LKW vs. Betonmischer) unterschiedlich aufgebaut ist.
Anwendungsszenarien:
Erdmann sieht den Batteriewechsel vor allem bei spezialisierten Anwendungen als sinnvoll an, wo sehr kurze Umschlagzeiten von 10-15 Minuten notwendig sind und selbst Megawatt-Charging nicht schnell genug wäre. In China ist diese Technologie bereits ein dominierender Pfad; mehr als jeder zweite batterieelektrische LKW ist dort mit wechselbaren Batterien ausgestattet.
Zellchemie und Zellformate.
Duale Strategie (NMC & LFP):
Aktuell stattet Designwerk etwa zwei Drittel seiner Fahrzeuge mit NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Kobalt) aus, da diese eine sehr hohe Energiedichte von ca. 180 Wh/kg auf Packebene bieten. Parallel dazu werden aber alle Fahrzeuge auch mit LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat) angeboten.
Zukunft liegt bei LFP:
Erdmann kündigt an, dass Designwerk keine neuen NMC-Batterien mehr entwickeln wird, sondern sich vollständig auf LFP konzentrieren wird. Die Gründe dafür sind:
- Die Verbesserungsrate bei LFP war in den letzten Jahren höher als bei NMC.
- Die Produktionskapazitäten in China werden massiv ausgebaut, was die Preise senkt. LFP-Zellen sind im Einkauf etwa 25-40 % günstiger als NMC-Zellen.
- Einige Batteriehersteller entwickeln NMC nicht mehr weiter.
- Die Zukunft wird daher in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr wahrscheinlich bei LFP liegen.
Nächster Schritt LMFP:
Als Weiterentwicklung der LFP-Chemie werden LMFP-Zellen (mit Mangan angereichert) in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Massenproduktion gehen. Diese Technologie erhöht die Energiedichte um 10-15 %, wodurch LFP-Batterien das Niveau von NMC-Batterien erreichen können.
Temperaturfenster beim Laden:
LFP-Zellen sind thermisch stabiler. Während bei NMC-Zellen die Ladeleistung bereits ab 40-45 °C stark reduziert wird, um die Lebensdauer nicht zu beeinträchtigen, sind bei LFP-Zellen Temperaturen bis zu 60 °C denkbar.
Zellformat:
Im Gegensatz zum PKW-Markt, wo verschiedene Formate genutzt werden, hat sich der LKW-Markt laut Erdmann sehr einheitlich auf prismatische Zellen fokussiert.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine
Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem
Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Anmerkung:
Für die Schweiz gelten im Verhältnis zu Deutschland ähnliche Daten und Voraussetzungen.
Geladen - Batteriepodcast zur Energiewende.
Mit bestem Dank an "Geladen - Batteriepodcast zur Energiewende" für das Video und das interessante Gespräch.
Quellenverzeichnis (September 2025)
Record Reichweite Lkw Batterien, geladen Batteriepodcast
Https://m.youtube.com/watch?v=N9QTa9H3_to
https://www.strategyand.pwc.com/de/de/presse/durchbruch-von-e-lkw.html
StratES-Szenarien-Elektrifizierung-Strassengueterverkehr:
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/StratES-Szenarien-Elektrifizierung-Strassengueterverkehr.pdf