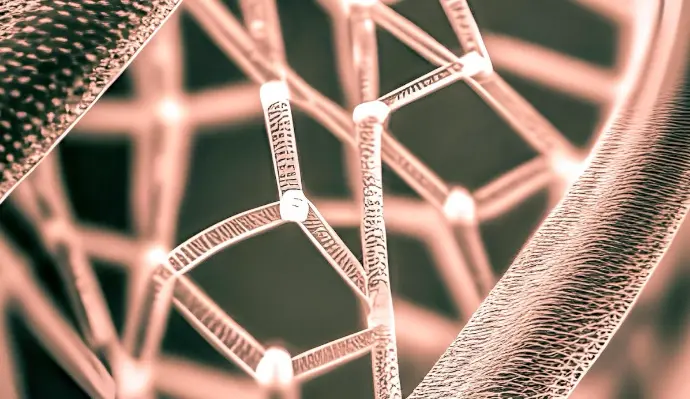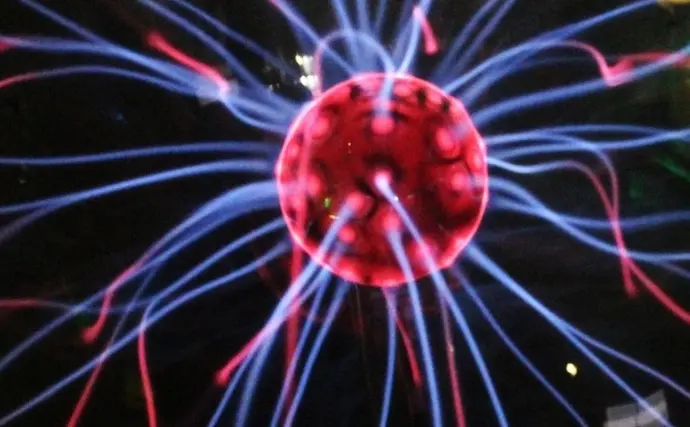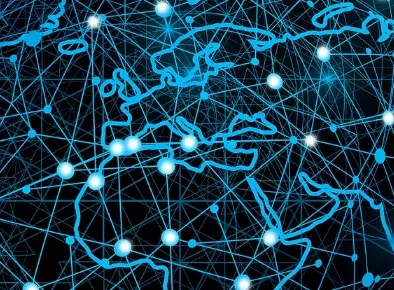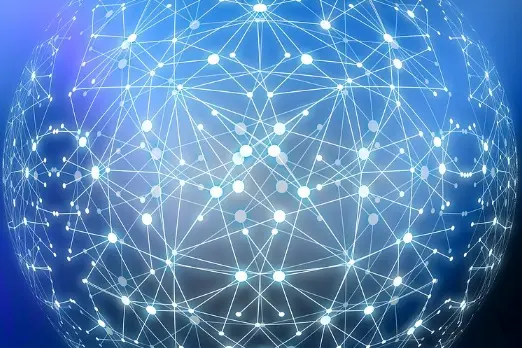Batteriematerialien in der Elektrofahrzeugindustrie: von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling, Mythos Seltenen Erden.
8.10.2025
Inhaltsverzeichnis.
Zusammenfassung Batteriematerialien.
Was sind Kathodenaktivmaterialien (CAM)?
Hocheffiziente Verfahren mit geringen Ausbeuteverlusten und hoher Energieeffizienz.
Vorteile der Zellchemien NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) und NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium).
Vorteile von manganreichen Materialien (wie LMR und LMO).
Manganreiche Kathodenchemie – Beispiel MG4 (Elektroauto).
Vorteile von Lithiumeisenphosphat (LFP).
Anodenfreie Zellen und Batterien.
Kathodenmaterialien für Semikörperbatterien.
Seltene Erden - welches sind die 17 chemischen Elemente?
Mythos: Seltene Erden sind in den Akkus von Elektroautos enthalten.
Seltene Erden - geopolitische Abhängigkeit von Europa ist hoch.
Zusammenfassung Batteriematerialien.
Ein Überblick über die Herausforderungen, Technologien und geopolitischen Aspekte der Batteriematerialien und Seltenen Erden in der Elektrofahrzeugindustrie.
1. Batteriematerialien und europäische Wettbewerbsfähigkeit.
Deutschland und Europa sind in der Batteriewertschöpfungskette, insbesondere bei der Batteriezellproduktion, stark von Asien (China, Korea, Japan) abhängig. Im Bereich der Kathodenaktivmaterialien (CAM), die massgeblich für die Performance, Reichweite, Kosten und Sicherheit von Batteriezellen verantwortlich sind, sieht sich der Westen jedoch auf Augenhöhe mit asiatischen Herstellern. Unternehmen wie BASF nutzen ihre tiefen Wurzeln in der Katalysatorherstellung zur Produktion dieser Materialien, die typischerweise Lithium, Nickel und Kobalt enthalten.
Die grösste Herausforderung für die europäische Produktion sind die höheren Kosten. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen hocheffiziente Verfahren mit geringen Ausbeuteverlusten und hoher Energieeffizienz entwickelt werden. Angesichts einer Verlangsamung des Marktwachstums für Elektromobilität in der westlichen Welt Ende 2023/Anfang 2024 mussten geplante Kapazitätsausbauten (wie die Investition von BASF von ursprünglich 4,5 Mrd. €) an die aktuellen Marktrealitäten angepasst werden.
Ein wichtiger Fokus liegt auf der Entwicklung neuer Zellchemien:
- NCM/NCA-Chemien sind weiterhin dominant, wobei die Tendenz besteht, Nickel- und Kobaltgehalte zu reduzieren, um Kosten zu senken.
- Manganreiche Materialien (wie LMR und LMO) sind ein wichtiger Entwicklungsstrang zur Kostenoptimierung, da sie potenziell die Energiedichten von Hochnickelmaterialien erreichen oder im Mix mit NCM (LMO/NCM-Mischungen) eine kostengünstige und leistungsstarke Alternative zu LFP bieten können.
- Lithiumeisenphosphat (LFP) erlebt eine Wiedergeburt, ist jedoch materialseitig weniger leistungsstark als Nickel-haltige Chemien und erschwert das wirtschaftliche Recycling, da ausser Lithium kaum werthaltige Stoffe enthalten sind.
2. Innovationen bei Batterietechnologien (Anodenfrei und Semi-Festkörper)
Neue Architekturen wie anodenfreie Batterien (z.B. CATLs "self forming anode technology") werden stark vorangetrieben. Diese Bauweise kann den Produktionsaufwand halbieren, das Volumen um bis zu 50% reduzieren und die spezifische Energie um 50% bis 60% steigern (bis zu 1000 Wh/L mit NMC-Kathoden). Die Anode bildet sich dabei beim ersten Ladevorgang aus Lithium-Ionen auf einem Kupferstromableiter.
Allerdings sind anodenfreie Zellen typischerweise an Feststoffbatterien gekoppelt (da reines Lithiummetall zu reaktiv für flüssige Elektrolyte ist). Feststoffbatterien stehen vor grossen Herausforderungen: Sie erfordern hohe Produktionsdrücke, sind teuer und leiden unter der Bildung von Lithium-Dendriten, welche die Lebensdauer drastisch reduzieren können.
Als Zwischenlösung dienen Semi-Festkörperbatterien, die zusätzlich flüssige Komponenten enthalten. Kommerzielle Anwendungen starten: Beispielsweise liefert BASF Kathodenmaterialien für Semikörperbatterien von WeLion. Auch in China kommen erste Massen-Pkw mit Semi-Feststoffakkus (z.B. der MG4 ab Ende 2024, wobei hier auch manganreiche Kathodenchemie eingesetzt wird) auf den Markt.
Eine weitere Strategie ist die Dual-Chemistry-Architektur (vorgeschlagen von CATL), bei der Zellen mit extrem hoher Dichte (wie anodenfreie Zellen) nur für Langstreckenfahrten aktiviert werden, während herkömmliche Zellen (NMC, LFP) den Alltag abdecken, um die vorschnelle Alterung der Hochleistungskomponenten zu verhindern.
3. Mythos Seltene Erden (SEE) – Vorkommen, Verwendung und Abhängigkeit.
Seltene Erden (17 chemische Elemente) sind entgegen ihrem Namen nicht selten und kommen teils häufiger vor als Kupfer. Sie sind nicht in den Akkus von Elektroautos enthalten, werden jedoch unverzichtbar für die E-Mobilität:
- Sie werden für Dauermagnete in Elektromotoren verwendet (insbesondere Neodym).
- Seltene Erden sind auch essentiell für Windkraftanlagen (Dysprosium, Neodym, Praseodym, Terbium), Photovoltaik, Elektronik und sogar Katalysatoren in Verbrennerautos.
Die geopolitische Abhängigkeit ist hoch: China dominiert den Abbau (ca. 68% der Weltproduktion) und die Weiterverarbeitung (fast 90% Marktanteil). Historisches Dumping und Missachtung von Umweltstandards (Giftschlämme) haben Chinas Vormachtstellung gefestigt.
Die EU stuft SEE als kritische Rohstoffe ein. Durch den „Critical Raw Materials Act“ (CRMA) soll die Versorgungssicherheit verbessert werden, mit dem Ziel, bis 2030 zehn Prozent des Bedarfs durch Bergbau innerhalb der EU zu decken. Grosse Hoffnungen ruhen auf dem kürzlich entdeckten Vorkommen in Lappland, dessen Erschliessung aber 10 bis 15 Jahre dauern kann.
Die langfristige Sicherung der Rohstoffe und die Verbesserung der Nachhaltigkeit erfordert einen starken Fokus auf Batterie-Recycling. Das Ziel der Wertschöpfungskette muss es sein, Metalle aus gebrauchten Batterien zurückzugewinnen:
Recycling-Prozesse: Hauptsächlich wird zunächst Schwarzmasse hergestellt (eine Konzentration von Nickel, Kobalt und Lithium aus Altbatterien oder Produktionsabfall). Die weitere Auftrennung in Einzelkomponenten erfolgt derzeit noch über Partner, soll aber bei ausreichendem Volumen zukünftig in einer eigenen Metallraffinerie geschehen.
Wirtschaftlichkeit und Ausbeute: Technisch sind Ausbeuten von bis zu 99% möglich, allerdings wird die Obergrenze durch die Wirtschaftlichkeit bestimmt. Für Nickel und Kobalt werden 96–97% und für Lithium 93–94% als sinnvoller Bereich genannt.
Seltene Erden -Recycling: Das Recycling von Seltenen Erden steckt noch in den Anfängen (aktuell nur etwa 1% Recyclingquote), ist aber technisch mit pyrometallurgischen oder hydrometallurgischen Verfahren möglich. Europa baut hier Kapazitäten auf, wie die Magnet-Recyclinganlage in Bitterfeld.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis.
Was sind Kathodenaktivmaterialien und welche Funktion erfüllen sie?
1. Definition und Funktion.
Standort und Zweck: Kathodenaktivmaterialien (CAM) sind die Stoffe, die auf die positive Elektrode (Kathode) einer Batteriezelle aufgetragen werden.
Leistungsbestimmung: Sie tragen massgeblich zur Performance der Batteriezelle bei.
Einflussfaktoren: CAM bestimmen wichtige Parameter wie:
- Die Leistungsfähigkeit und Kapazität der Zelle.
- Die daraus resultierende Reichweite des Autos.
- Die Kosten.
- Die Sicherheit der Batterie.
2. Chemische Zusammensetzung und Typen.
Klassische Kathodenaktivmaterialien sind in der Regel anorganische Materialien. Zu den gängigen Materialtypen gehören:
- Nickel-Kobalt-Chemien: Dies sind typischerweise Lithiumverbindungen, die Lithium, Nickel und Kobalt enthalten. Gängige Chemien in der Elektromobilität sind:
- NCM (Nickel, Kobalt, Mangan).
- NCA (Nickel, Kobalt, Aluminium).
- NCMA (eine Unterform).
- Generell gilt: Je höher der Nickelgehalt ist, desto höher ist in der Regel die erzielbare Energiedichte.
- Lithiumeisenphosphat (LFP): Dies ist eine weitere klassische Kathodenchemie. LFP hat materialseitig eine geringere elektrochemische Performance als nickelhaltige Materialien, erlebt jedoch eine Wiedergeburt, da Fortschritte im Zell- und Packdesign die Materialnachteile kompensiert haben.
- Manganreiche Materialien: Ein wichtiger Entwicklungsbereich sind manganreiche Kathodenmaterialien wie LMR (Lithium Manganese Rich) oder das ältere Material LMO (Lithiummanganoxid).
3. Herstellungsprozess.
Die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien ist ein komplexer mehrstufiger Prozess, der in vereinfachter Form 15 Einzelschritte umfassen kann:
1. Rohstoffbeschaffung: Zunächst werden Metallsalze (wie Nickelsulfat, Kobaltsulfat, Mangansulfat, Lithiumhydroxid oder Karbonate) von Bergbau- oder Raffinerieunternehmen beschafft.
2. Precursor-Herstellung: Aus den Nickel-, Kobalt- und Aluminiumverbindungen wird ein sogenannter Precursor (eine Mischung aus Hydroxyden/Oxyden) hergestellt, indem die Metallsalze gefällt, filtriert und getrocknet werden.
3. Kalzination: Die Vorstufen (Precursor) werden mit Lithiumsalzen vermischt und anschliessend in langen Rollenherdöfen (RH Cases) „gebacken“ (kalziniert). Die "Kunst" dieses Prozesses liegt in der Einstellung der Temperaturrampen, um die gewünschten Kristallstrukturen zu erhalten.
4. Veredelung: Nach der ersten Kalzinierung folgen in der Regel weitere Schritte wie Beschichtungen und zusätzliche Kalzinierungen (teilweise bis zu vierstufig). Diese dienen dazu, die Betriebssicherheit, die Zyklenstabilität und die Kapazität weiter zu erhöhen.
Die hohen Qualitätsanforderungen an die Produktreinheit (zum Beispiel das penible Entfernen magnetischer Verunreinigungen) sind entscheidend für die Betriebssicherheit der späteren Batteriezelle.
Massgeblichen Materialien und Herstellungsprozesse für die Performance, Reichweite, Kosten und Sicherheit von Batteriezellen.
A. Materialien, die Performance, Reichweite und Sicherheit bestimmen.
Die Performance, Reichweite, Kosten und Sicherheit einer Batteriezelle werden massgeblich durch die Kathodenaktivmaterialien (CAM) bestimmt.
Materialtyp: Nickel-Kobalt-Chemien.
- Chemische Zusammensetzung: Lithiumverbindungen, die Lithium, Nickel und Kobalt enthalten. Gängige Typen sind NCM, NCA, NCMA.
- Einfluss auf Performance/Reichweite: Der Nickelgehalt (z.B. 85 bis 95 Mol%) korreliert direkt mit einer höheren Energiedichte. Hohe Energiedichten bis zu 350 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) sind möglich.
- Einfluss auf Sicherheit/Kosten: Kobalt ist ein relativ teures Metall, dessen Reduzierung von vielen Zellherstellern gefordert wird. Hochnickelhaltige Systeme sind in der Produktion empfindlicher gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit.
Materialtyp: Reines Lithium-Metall.
- Chemische Zusammensetzung: Reines metallisches Lithium.
- Einfluss auf Performance/Reichweite: Gilt als der heilige Gral der Batterietechnik und speichert am meisten Lithium-Ionen pro Gewicht.
- Einfluss auf Sicherheit/Kosten: Sicherheitsproblem: Ist zu reaktiv und geht mit normalen, flüssigen Elektrolyten schnell in Flammen auf. Wird nur in Verbindung mit Feststoffelektrolyten in anodenfreien Batterien angestrebt.
B. Materialien zur Kostenoptimierung.
Um die Batteriekosten zu senken und die Rohstoffabhängigkeit zu verringern, werden Alternativen zu hochnickelhaltigen CAMs entwickelt:
1. Lithiumeisenphosphat (LFP):
- Kosten: LFP hat eine Wiedergeburt erlebt, da es günstiger ist.
- Leistung: LFP bietet materialseitig eine geringere elektrochemische Performance als nickelhaltige Materialien.
- Designmassnahmen auf Zell- und Packebene können jedoch die Materialnachteile kompensieren.
- Recycling und Kosten: Beim Recycling von LFP ist am Ende letztlich nur noch Lithium als werthaltiger Stoff enthalten, was die Wirtschaftlichkeit der Rückführung stark erschwert.
2. Manganreiche Chemien:
Ziel: Manganreiche Kathodenmaterialien wie LMR (Lithium Manganese Rich) oder LMO (Lithiummanganoxid) sind ein wichtiger Entwicklungsstrang.
- Performance/Kosten: Diese Materialien sind besonders billig und können, wenn sie richtig betrieben werden, sogardie Energiedichten von Hochnickelmaterialien schlagen.
- Strategie (Mischung): LMO kann als Alleinlösung oder in Mischung mit nickelhaltigen Kathodenmaterialien (LMO/NCM-Mischungen) verwendet werden. Dies ermöglicht eine Optimierung der Kosten pro Kilowattstunde mit der Energiedichte. Solche Mischungen sind vielversprechende Hoffnungsträger, um zu ähnlich günstigen Preisen wie LFP zu kommen.
- Herausforderung: Manganreiche Chemien benötigen eine relativ hohe Zellspannung (bis zu 4,7 Volt und mehr), wobei flüssige Elektrolyte bei diesen Spannungen zur Zersetzung neigen. Ausserdem sind manganreiche Materialien in Kombination mit flüssigen Elektrolyten sehr instabil, da sich das Mangan auflöst.
C. Innovationen in der Zellarchitektur (Performance und Sicherheit).
Neue Batteriekonzepte zielen darauf ab, die Energiedichte zu maximieren und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken:
1. Anodenfreie Batterien ("Anode-Free Batteries" / "Self Forming Anode Technology"):
Konzept: Beim ersten Aufladen bildet sich die Anode innerhalb der Batteriezelle: Lithium-Ionen wandern von der Kathode zu einem Kupferstromableiter und lagern sich dort metallisch ab.
Vorteile (Performance/Kosten):
- Reduziert den Produktionsaufwand um die Hälfte.
- Reduziert das Volumen um bis zu 50 %.
- Erhöht die Energiedichte um 60 % und die spezifische Energie (pro Gewicht) um 50 % gegenüber klassischen Lithium-Ionen-Zellen.
- Kann mit NMC-Kathoden eine Zell-Energiedichte von 1000 Wh pro Liter erreichen.
- Spart die Produktion einer Anode (bis zu 20-30 % des Zellpreises) und den energieaufwendigen Formierungsschritt.
Nachteile (Sicherheit/Lebensdauer):
- Die Technologie erfordert den Einsatz von Feststoffelektrolyten, da flüssige Elektrolyte in Kombination mit reaktivem Lithium gefährlich sind.
- Die Lebensdauer ist problematisch, da sich das Lithium auf dem Ableiter inhomogen abscheidet und Lithium-Dendriten (kleine Lithium-Äste) wachsen, welche die Kapazität und Lebensdauer drastisch reduzieren oder Kurzschlüsse auslösen können.
2. Festkörper- und Semi-Festkörperbatterien (Solid-State):
- Zweck: Dienen dazu, die Sicherheit von Batterien mit reaktivem Lithium zu gewährleisten. Sie gelten als der Heilige Gral zur Steigerung der Reichweiten.
- Semi-Festkörper (Semi-Solid State): Sind eine Zwischenlösung, bei der der Elektrolyt grösstenteils fest ist, aber noch flüssige Komponenten (z.B. 5 % Flüssigkeit) enthält. Die flüssigen Komponenten sollen die Probleme der Volumenkontraktion und Expansion in All-Solid-State-Batterien mindern.
- Herausforderungen: Feststoffbatterien sind derzeit extrem teuer und erfordern in der Produktion und im Akkupack hohe Drücke, um einen guten leitenden Kontakt zu gewährleisten.
D. Herstellungsprozesse und Effizienz (Kosten und Sicherheit).
Der Herstellungsprozess der Kathodenaktivmaterialien ist entscheidend für die Qualität, Kosten und Betriebssicherheit der Zelle.
1. Wirtschaftliche Effizienz (Kosten):
Um in der westlichen Welt wettbewerbsfähig gegenüber asiatischen Herstellern zu produzieren (wo die Kosten generell höher sind), müssen die Produktionsverfahren hocheffizient sein.
Dies erfordert: Geringe Ausbeuteverluste, hohe Energieeffizienzen und hohe Durchsätze durch die Anlagen.
2. Herstellungsprozess von Kathodenaktivmaterialien (CAM):
Der Prozess ist heutzutage komplex und besteht aus bis zu 15 Einzelschritten.
- Precursor-Herstellung: Zuerst werden Metallsalze (wie Nickel-, Kobalt-, Mangansulfat, Lithiumhydroxid) beschafft. Aus Nickel-, Kobalt- und Aluminiumverbindungen wird ein sogenannter Precursor (Mischhydroxid) durch Fällen, Filtrieren und Trocknen hergestellt.
- Kalzination: Die Vorstufen werden mit Lithiumsalzen vermischt und in langen Rollenherdöfen (RH Cases, bis zu 100 m Länge) "gebacken" (kalziniert). Die "Kunst" des Kalzinierens liegt in der genauen Einstellung der Temperaturrampen, um die gewünschten Kristallstrukturen und damit die richtige Performance zu erhalten.
- Veredelung: Nach der ersten Kalzinierung folgen in der Regel mehrere Beschichtungs- und Kalzinierungsschritte (teilweise bis zu vierstufig). Diese erhöhen die Betriebssicherheit, die Zyklenstabilität (bessere Haltbarkeit beim Be- und Entladen) und die Kapazität.
3. Qualität und Sicherheit in der Produktion:
Es herrschen immens hohe Qualitätsanforderungen an die Produktreinheit.
Um die Betriebssicherheit der späteren Batteriezelle zu gewährleisten, müssen
magnetische Verunreinigungen (z.B. Eisenspäne) penibelst aus dem Produkt entfernt werden. Dies geschieht durch unzählige Siebvorgänge und den Einsatz von Magneten.
Zudem sind umfangreiche Schutzmassnahmen für Mitarbeiter und Umwelt notwendig, da die Materialien Nickel, Kobalt und Lithium reizende und gefährliche Stoffe sind.
Hocheffiziente Verfahren mit geringen Ausbeuteverlusten und hoher Energieeffizienz.
Die hocheffizienten Verfahren mit geringen Ausbeuteverlusten und hoher Energieeffizienz sind für europäische Hersteller von Batteriematerialien immens wichtig, um die generell höheren Investitions- und Betreiberkosten im Vergleich zu asiatischen Wettbewerbern (z.B. China) zu kompensieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.
1. Kriterien der Hocheffizienz (Ziele).
Hocheffiziente Produktionsverfahren müssen folgende Kriterien erfüllen, um die Kostennachteile gegenüber asiatischen Regionen auszugleichen:
- Geringe Ausbeuteverluste: Die Verfahren müssen so optimiert sein, dass nur geringe Mengen des wertvollen Materials im Prozess verloren gehen.
- Hohe Energieeffizienzen: Es müssen geringe Energieverbräuche im Herstellungsprozess gewährleistet werden.
- Hoher Durchsatz: Es müssen sehr hohe Durchsätze durch die Anlagen erfolgen, um die Wirtschaftlichkeit des komplexen Prozesses sicherzustellen.
2. Verfahrensmerkmale und Umsetzung.
Das Kerngeschäft dieser hocheffizienten Prozesse ist die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAM), die aus bis zu 15 Einzelschritten bestehen. Die Effizienz wird durch folgende Designprinzipien erreicht:
A. Automatisierung und Qualitätssicherung.
- Hohe Automatisierung: Die Produktionsstätte in Schwarzheide, beispielsweise, zeichnet sich durch eine Automatisierung aus, bei der relativ wenige Mitarbeiter in der Produktionsstätte benötigt werden.
- Keine manuelle Intervention: Nach dem Einfüllen der Rohmaterialien (Metallsalze, Lithiumsalze) in die Vorlagebehälter läuft der Prozess mehr oder weniger automatisch durch die Produktion durch.
- Qualität und Fehlervermeidung: Diese automatische Prozessführung ist ein Qualitätsmerkmal für die Kunden, da sie möglichst wenig Kontamination und weniger Fehlerquellen bei der Produktion gewährleistet.
B. Optimierte Wärmebehandlung (Kalzination).
Die Kalzination ("Backen") der Kathodenmaterialien ist ein zentraler und energieintensiver Schritt, der hocheffizient gestaltet werden muss:
- Lange Rollenherdöfen (RH Cases): Die Materialien (Vorstufen und Lithiumsalze) werden in immens langen Rollenherdöfen kalziniert, wobei die neuesten Öfen bis zu 100 Meter Länge erreichen können.
- Temperaturkontrolle: Die „Kunst“ des Kalzinierens liegt in der genauen Einstellung der Temperaturrampen (Aufheizen, Halten, Abkühlen), um die gewünschten Kristallstrukturen und damit die richtige Performance zu erhalten.
C. Mehrstufige Veredelung.
Um die Leistungsfähigkeit (Performance), die Zyklenstabilität und die Betriebssicherheit zu steigern – was letztlich die Qualität und den Wert des Materials erhöht – ist eine effiziente Gestaltung der Veredelung notwendig:
- Beschichtungs- und Kalzinierungsschritte: Nach der ersten Kalzination schliessen sich in der Regel mehrere Beschichtungs- und Kalzinierungsschritte an, die teilweise bis zu vierstufig sein können.
- Zweck der Veredelung: Diese Schritte dienen dazu, besondere Elemente aufzubringen, die die Kapazität weiter nach oben bringen, die Zyklenstabilität (Haltbarkeit beim Be- und Entladen) erhöhen und die Betriebssicherheit verbessern.
D. Reinheit und Sicherheit.
Um geringe Ausbeuteverluste zu gewährleisten und die Sicherheit zu maximieren, sind hohe Qualitätsstandards erforderlich:
- Entfernung von Verunreinigungen: Es gibt immens hohe Qualitätsanforderungen an die Produktreinheit, die direkt in die Betriebssicherheit einfliessen.
- Sieb- und Magnetvorgänge: Magnetische Verunreinigungen (z.B. Eisenspäne) müssen penibelst entfernt werden, was durch unzählige Siebvorgänge und den Einsatz von Magneten geschieht.
Moderne Produktionsanlagen sind gute Beispiele dafür, wie diese hocheffizienten Verfahren implementiert werden, indem „exzellente Durchsätze“ bei „geringen Energieverbräuchen“ und „sehr sehr geringen Ausbeuteverlusten“ erzielt werden.
Vorteile der Zellchemien NCM (Nickel-Kobalt-Mangan) und NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium).
Beschreibung der Zellchemien NCM und NCA.
NCM und NCA sind die dominierenden Typen von Kathodenaktivmaterialien (CAM) in der Elektromobilität und werden als Nickel-Kobalt-Chemien zusammengefasst.
1. Zusammensetzung:
- Diese Materialien bestehen in der Regel aus Lithium, Nickel und Kobalt.
- NCM enthält zusätzlich Mangan.
- NCA enthält zusätzlich Aluminium.
2. Rolle in der Wertschöpfungskette:
- NCM, NCA und Unterformen wie NCMA (Nickel-Kobalt-Mangan-Aluminium) sind die Hauptmaterialien, die in die Elektromobilität einfliessen.
- Sie werden auch in anderen Bereichen wie Power Tools, E-Bikes und in geringerem Masse in Consumer Electronics (dort dominiert LCO) verwendet.
3. Varianten (Nickelgehalt):
- Die Chemien werden nach dem Anteil des enthaltenen Nickels unterschieden, der in Molprozent angegeben wird.
- Hochnickelhaltige Systeme: Diese enthalten zwischen 85 und 95 Mol% Nickel.
- Mittlere Nickel-Systeme: Diese liegen typischerweise zwischen 60 und 70 Mol% Nickel (neben Kobalt, Aluminium und/oder Mangan).
Vorteile und Herausforderungen von NCM/NCA.
Die Hauptvorteile dieser Chemien liegen in ihrer Leistungsfähigkeit, sie bringen aber auch spezifische Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf Kosten und Verarbeitung.
Kriterium |
Vorteile (V) und Herausforderungen (H) |
Details. |
|
Performance und Reichweite (V) |
Hohe Energiedichte durch hohen Nickelgehalt. |
Je höher der Nickelgehalt ist, desto höher ist in der Regel die erzielbare Energiedichte. Es können Energiedichten von bis zu 350 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) abgebildet werden. |
|
Kosten (H) |
Die Materialien enthalten teure Metalle wie Kobalt und Nickel. |
Kobalt ist ein relativ teures Metall, das in den letzten Jahren starke Preisausschläge nach oben hatte, weshalb viele Zellhersteller eine Reduzierung des Kobaltgehalts fordern. |
|
Verarbeitbarkeit (H/V) |
Hochnickelhaltige Systeme sind in der Produktion empfindlich. |
Systeme mit weniger Nickel sind deutlich einfacher in der Produktion zu verarbeiten, da sie weniger empfindlich gegenüber der Atmosphäre (Sauerstoff und Feuchtigkeit) sind. |
|
Alternative Leistungssteigerung (V) |
Energiedichte kann auch ohne Erhöhung des Nickelgehalts gesteigert werden. |
Anstatt den Nickelgehalt zu erhöhen, kann auch die Zellspannung angehoben werden (z.B. bei niedrigeren Nickel-Systemen). Dies führt auf Zellniveau zu sehr hohen Energiedichten, während ein deutlich leichter zu verarbeitendes Material verwendet wird. |
|
Recycling (V) |
Gute Wirtschaftlichkeit der Rückführung von Rohstoffen. |
Im Gegensatz zu LFP (Lithiumeisenphosphat), bei dem am Ende nur Lithium als werthaltig gilt, können bei NCM/NCA-Materialien Lithium, Nickel und Kobalt rezykliert werden, was den Recycling-Betrieb wirtschaftlicher macht. |
Strategische Optimierung.
Die Industrie arbeitet daran, die Nachteile der NCM/NCA-Chemien zu mildern und ihre Vorteile zu optimieren:
- Reduzierung von Kobalt und Nickel: Es werden Kartodenmaterialien entwickelt, bei denen beide Metalle reduziert oder optimiert werden, beispielsweise durch spezielle Oberflächen- oder Partikelgrössenanpassungen.
- Kobaltfreie Systeme: Es existieren bereits hochnickelhaltige, kobaltfreie Systeme im Portfolio von Materialherstellern.
- Mischungen: NCM-Materialien werden auch in Mischung mit manganreichen Kathodenmaterialien wie LMO (Lithiummanganoxid) verwendet. Diese Mischungen können helfen, die Kosten pro Kilowattstunde zu optimieren und gleichzeitig die Energiedichte zu steigern. Sie sind ein vielversprechender Hoffnungsträger, um ähnlich günstige Preise wie bei LFP zu erzielen, aber mit Vorteilen bei der Tieftemperaturaktivität.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis.
Vorteile von manganreichen Materialien (wie LMR und LMO).
Die manganreichen Materialien, wie Lithium Manganese Rich (LMR) und Lithiummanganoxid (LMO), stellen einen wichtigen Entwicklungsstrang bei den Kathodenmaterialien (CAM) dar und bieten mehrere entscheidende Vorteile, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Leistungsdichte und strategische Einsatzmöglichkeiten in neuen Batteriearchitekturen.
Vorteile dieser Zellchemien:
1. Leistungspotenzial und Energiedichte:
- Hohe theoretische Energiedichte: Manganreiche Materialien (wie LMR/LMA) gelten als "Traummaterialien". Wenn diese Materialien richtig betrieben werden, können sie mit ihrem niedrigen Nickelgehalt (etwa 30 bis 35 Mol% Nickel) sogar die Energiedichten von Hochnickelmaterialien übertreffen.
- Betriebsspannung: Um dieses hohe Leistungspotenzial abzurufen, müssen die Zellen jedoch bei relativ hohen Zellspannungen (bis zu 4,7 Volt und mehr) betrieben werden.
2. Kostenoptimierung:
Günstige Basischemie: LMO (Lithium-Mangan-Oxid) gilt als eine besonders billige Chemie.
- Kosten- und Energiedichte-Optimierung durch Mischung: Eine vielversprechende Strategie ist die Verwendung von LMO in Mischung mit nickelhaltigen Kathodenmaterialien (NCM). Durch das Mischen kann sehr gut die Kosten pro Kilowattstunde mit der Energiedichte pro Kilogramm oder Volumen optimiert werden.
- Wettbewerbsfähig zu LFP: Solche Mischungen sind ein sehr vielversprechender Hoffnungsträger, um zu ähnlich günstigen Preisen zu kommen wie beim Lithiumeisenphosphat (LFP).
3. Vorteile gegenüber LFP (Lithiumeisenphosphat):
Im Vergleich zu den kostengünstigen LFP-Zellen, die materialseitig weniger leistungsstark sind [9: 22:05], bieten manganreiche Materialien, insbesondere in NCM-Mischungen, einen klaren Vorteil:
- Bessere Tieftemperaturaktivität: Die Mischungen aus LMO und NCM sind in Bezug auf die Tieftemperaturaktivität (Leistung bei Kälte) deutlich vielversprechender als LFP.
4. Stabilisierung durch Festkörpertechnologie:
- Lösung für Instabilität: Manganreiche Kathodenmaterialien neigen dazu, in Kombination mit flüssigen Elektrolyten sehr instabil zu sein, da sich das Mangan auflöst.
- Einsatz in Solid-State-Batterien: Diese Materialien sind prädestiniert für einen Einsatz in der Solid-State-Batterie (Festkörperbatterie), da dort kein flüssiger Elektrolyt mehr vorhanden ist und man einfacher zu den hohen Zellspannungen kommen kann.
- Kosten-Revolution: Die Wahl eines (Semi-)Feststoffelektrolyten in aktuellen Anwendungen könnte primär dazu dienen, diese manganreichen Kathodenchemienen zu stabilisieren. Dies könnte, anstatt einer reinen Reichweiten-Revolution, zu einer Kosten-Revolution führen, da billiges Mangan die teure Feststoff-Akkuproduktion schneller in den Massenmarkt bringen kann.
Manganreiche Kathodenchemie – Beispiel MG4 (Elektroauto).
Informationen zur Markteinführung des MG4 und dem Einsatz von manganreicher Kathodenchemie.
1. Markteinführung und Fahrzeugtyp:
Der MG4 ist das erste Massenfahrzeug, das mit einem Semi-Feststoffakku auf den Markt kommen soll:
- Die Marke MG gehört dem chinesischen Hersteller SAIC Motor.
- Das Modell soll ab Ende September in China vorbestellbar und noch dieses Jahr (2024) ausgeliefert werden.
- Es handelt sich dabei um ein Kompaktfahrzeug und nicht um ein teures Premium-Fahrzeug, was für eine neue Hochtechnologie ungewöhnlich ist.
- Das neue Modell soll mit einer Akkukapazität von 70 kWh auf den Markt kommen.
2. Technologie: Semi-Feststoffakku:
- Es handelt sich nicht um einen reinen Feststoffakku, sondern um einen Semi-Feststoffakku.
- Der Elektrolyt in dieser Batterie enthält grösstenteils feste Bestandteile, ist aber zu 5 % noch flüssig.
- Die angegebene spezifische Energie des Akkus soll 180 Wh/kg betragen, was als obere Mittelklasse und nicht aussergewöhnlich eingestuft wird. Die Reichweite nach chinesischem Testzyklus wird mit 537 km angegeben.
3. Einsatz von manganreicher Kathodenchemie:
- Das bemerkenswerteste Detail ist, dass bei diesem Akku von einer neuen, manganreichen Kathodenchemie die Rede ist.
- Das bedeutet, dass weder die heute in fast jedem E-Auto verwendeten Chemien LFP (Lithiumeisenphosphat) noch NMC (Nickel-Mangan-Kobalt) zum Einsatz kommen.
- Es wird vermutet, dass es sich hierbei um LMO (Lithium-Mangan-Oxid) oder ein verwandtes Material handeln könnte.
- Vorteile der Mangan-Chemie: LMO gilt als besonders billige Chemie, die dennoch eine recht gute Energiedichte besitzt.
4. Strategische Bedeutung der Kombination (Mangan + Semi-Feststoff).
Die Kombination von Semi-Feststoff und Mangan wird als strategisch wichtig erachtet:
- Stabilisierung: Manganreiche Materialien sind in Kombination mit flüssigen Elektrolyten sehr instabil, da sich das Mangan im Flüssig-Elektrolyten auflöst.
- Es wird daher vermutet, dass die Wahl des Semi-Feststoffelektrolyten nicht primär dazu diente, die Reichweite zu erhöhen, sondern dazu, die manganreichen Kathodenchemien zu stabilisieren.
- Kostenrevolution: Diese Technologie könnte zu einer Kosten-Revolution statt einer reinen Reichweiten-Revolution führen. Die Nutzung von billigem Mangan könnte dazu beitragen, die als teuer geltende Feststoff-Akkuproduktion schneller in den Massenmarkt zu bringen und so die Preise für besonders reichweitenstarke Chemien zu senken.
Vorteile von Lithiumeisenphosphat (LFP).
Die Zellchemie Lithiumeisenphosphat (LFP), abgeleitet von dem klassischen Kathodenmaterial, hat in den letzten Jahren eine Wiedergeburt erlebt. Die Hauptvorteile von LFP liegen in den Bereichen Kosten und Langlebigkeit, auch wenn die materialseitige Leistung geringer ist als bei Nickel-Kobalt-Chemien.
Vorteile von Lithiumeisenphosphat.
1. Kosten und Marktakzeptanz.
- Kostengünstige Chemie: LFP ist bekannt dafür, günstiger zu sein als nickelhaltige Kathodenmaterialien.
- Wettbewerbsfähiger Preisanker: Es dient als Messlatte für Kosteneffizienz. Entwicklungsstränge wie manganreiche NCM-Mischungen haben das Ziel, zu ähnlich günstigen Preisen wie LFP zu kommen.
- Starker Markttrend: Insbesondere der chinesische Automobilmarkt verzeichnet eine grosse LFP-Welle, und auch europäische Hersteller ziehen in Betracht, LFP einzusetzen.
2. Design-Kompensation der Leistung.
- Obwohl LFP materialseitig weniger leistungsfähig ist als nickelhaltige Materialien (es wird nie die Performance eines nickelhaltigen Materials erreichen), wird es dennoch erfolgreich im Automobilbereich eingesetzt.
- Fortschritte im Design: Es wurden starke Fortschritte, insbesondere im Bereich des Zell- und Packdesigns, gemacht, um die materialseitigen Nachteile von LFP zu kompensieren.
3. Langlebigkeit und Anwendungssicherheit.
Hohe Langlebigkeit im Alltag: Im Konzept der Dual-Chemistry-Batterien (Batteriepacks mit zwei verschiedenen Chemien) werden die herkömmlichen LFP-Zellen für Alltagsfahrten genutzt, da sie durch ihre hohe Langlebigkeit punkten können. Dies steht im Gegensatz zu Hochleistungszellen (wie anodenfreie Zellen), deren vorschnelle Alterung durch diese Architektur vermieden werden soll.
4. Nachteil Recycling.
Die Kostenvorteile von LFP gehen mit einem inhärenten Nachteil im Recycling einher: Bei der Rückgewinnung aus LFP-Batterien ist am Ende letztlich nur noch Lithium als werthaltiger Stoff enthalten, was die Wirtschaftlichkeit des Recyclingbetriebs stark erschwert im Vergleich zu Nickel-Kobalt-Materialien (NCM), bei denen Lithium, Nickel und Kobalt rezykliert werden können.
Anodenfreie Zellen und Batterien.
Schlüsselentwicklungen von anodenfreien Batterien zur Steigerung von Energiedichte und Reichweite.
1. Beschreibung anodenfreier Batterien (Anode-Free Batteries).
Anodenfreie Batterien (auch bekannt als „self forming anode technology“) stellen ein radikal neues Batteriekonzept dar, bei dem die Anode nicht im Vorfeld produziert wird.
- Konzept: Während der Produktion wird keine Anode in die Batteriezelle eingebaut. Die Batterie besteht quasi nur aus einer „halben Batterie“.
- Anodenbildung: Die Anode bildet sich erst beim Aufladen innerhalb der Batteriezelle. Die Lithium-Ionen, die sich nach der Produktion in der Kathode befinden, wandern zum Kupferstromableiter. Dort kombinieren sie mit einem negativ geladenen Elektron und lagern sich metallisch als Lithium ab.
Vorteile (Performance & Kosten):
- Volumen und Aufwand: Diese Bauweise kann den Produktionsaufwand halbieren und das Volumen um bis zu 50 % einsparen.
- Kostenersparnis: Die Produktion einer Anode entfällt, die 20 bis 30 % des Preises einer Batteriezelle ausmachen kann.
- Lithium-Effizienz: Die Zelle enthält nur genau so viel Lithium, wie elektrochemisch benötigt wird, wodurch Überschüsse gespart werden.
- Prozesserparnis: Der energieaufwendige und teure Formierungsschritt in der Batterieproduktion (nötig zur Aktivierung von Graphit-Anoden) entfällt.
- Energiedichte: Die Technik verspricht eine Erhöhung der Energiedichte um 60 % und der spezifischen Energie (pro Gewicht) um 50 % gegenüber klassischen Lithium-Ionen-Zellen. In Kombination mit NMC-Kathoden soll eine Zell-Energiedichte von 1000 Wh pro Liter möglich sein (aktuelle Zellen: 600 bis 700 Wh/L).
2. Kopplung an Feststoffbatterien.
Anodenfreie Zellen sind aus Sicherheitsgründen typischerweise an Feststoffbatterien gekoppelt:
- Reaktivität von Lithium: Reines Lithium-Metall (das sich bei anodenfreien Zellen bildet) ist zu reaktiv.
- Sicherheitsrisiko: Bei der Verwendung von normalen, flüssigen Elektrolyten würde reines Lithium schnell in Flammen aufgehen (ein Problem, das bereits in den ersten Lithium-Metall-Batterien der 80er Jahre auftrat).
- Notwendigkeit von Feststoffen: Um reaktives Lithium sicher einsetzen zu können, muss auf den klassischen flüssigen Elektrolyten verzichtet und dieser durch einen Feststoffelektrolyten ersetzt werden.
3. Herausforderung: Bildung von Lithium-Dendriten.
Obwohl anodenfreie Feststoffbatterien theoretisch hohe Energiedichten ermöglichen, bringen sie durch ihre Architektur erhebliche Probleme in Bezug auf Lebensdauer und Sicherheit mit sich:
- Inhomogene Abscheidung: Das Lithium muss sich sehr gleichmässig auf der Kupfer-Ableiterfolie abscheiden, um reibungsfrei zu funktionieren. Lithium neigt jedoch dazu, sich inhomogen abzulagern – es scheidet sich am liebsten dort ab, wo bereits Lithium vorhanden ist.
- Dendritenwachstum: Anstelle einer glatten Oberfläche wachsen kleine Lithium-Äste (Dendriten).
Auswirkungen:
- Lebensdauer: Diese Äste brechen schnell ab und reduzieren damit die Kapazität und die Lebensdauer drastisch.
- Kurzschlüsse: Im schlimmsten Fall können Dendriten den festen Elektrolyten durchstechen und einen Kurzschluss auslösen.
- Ausschussrate: Schon kleinste Mengen an Fremdatomen oder Unebenheiten beschleunigen das Dendriten-Wachstum und erhöhen damit die Ausschussrate in Fabriken enorm.
- Zusätzliche Alterung: Selbst wenn sich das Lithium abbaut und wieder neu anwächst, reagiert es langsam mit den festen Elektrolyten. Jede dieser chemischen Reaktionen verbraucht Lithium und reduziert damit die Kapazität der Zelle.
4. Die Zwischenlösung: Semi-Festkörperbatterien.
Aufgrund der Herausforderungen bei reinen Festkörperbatterien (All-Solid-State) dienen Semi-Festkörperbatterien als wichtige Zwischenlösung:
- Definition: Bei Semi-Festkörperbatterien (Semi-Solid State) ist der Elektrolyt grösstenteils fest, enthält aber noch flüssige Komponenten (z.B. 5 % Flüssigkeit).
- Funktion der Flüssigkeit: Die flüssigen Komponenten sollen die Probleme, die man bei der All-Solid-State-Batterie (vollfeste Batterie) sieht, mindern. Speziell helfen sie, die Volumenkontraktion und -expansion auszugleichen: Im Betrieb „atmet“ die Batteriezelle stark, wodurch sich feste Elektrolyte von den Elektrodenmaterialien trennen könnten, Risse entstehen und die Leistungsfähigkeit sinkt. Die flüssigen Komponenten sollen diese Risse „kitten“.
Kommerzielle Anwendungen:
- WeLion: BASF hat Kathodenmaterial für die Semi-Festkörperbatterie des chinesischen Herstellers WeLion entwickelt, die bereits in Anwendungen wie elektrischen Drohnen und bei einem Automobilhersteller kommerziell eingesetzt wird.
- MG4: Das erste Massenfahrzeug mit Semi-Feststoffakku (der MG4, ab Ende 2024 in China) nutzt diese Technologie. Hierbei wird die Semi-Feststoffarchitektur möglicherweise primär dazu genutzt, manganreiche Kathodenchemien zu stabilisieren.
Kathodenmaterialien für Semikörperbatterien.
Die Kathodenmaterialien für die Semi-Festkörperbatterien des chinesischen Herstellers WeLion (auch Weline genannt) wurden in Kooperation mit der BASF entwickelt.
Die wichtigsten Details zu dieser Zusammenarbeit und der Technologie:
1. Beschreibung der Semi-Festkörperbatterie.
- Technologie: Kathodenmaterial für eine Semi-Festkörperbatterie (oder halbe Festkörperbatterie).
- Architektur: Diese Technologie ist eine Zwischenlösung für die All-Solid-State-Batterie (vollfeste Batterie). Der Elektrolyt ist zwar grösstenteils fest, enthält jedoch noch flüssige Komponenten (z.B. 5 % Flüssigkeit).
- Grund für die Zwischenlösung: Die flüssigen Komponenten dienen dazu, die Probleme der Volumenkontraktion und -expansion zu mindern, die beim Laden und Entladen der Zelle auftreten. Die Flüssigkeit kann Risse im festen Elektrolyten „kitten“, die entstehen, wenn sich der Elektrolyt vom Kathodenmaterial trennt.
2. Performance und Kommerzialisierung.
- Zielerreichung: Semi-Solid-State-Batterien haben bereits sehr hohe Energiedichten und eine stabile Betriebssicherheit.
- Marktstatus: Verschiedene Varianten der Semi-Festkörperbatterie sind bereits in der Produktion.
- Anwendungen: Die Batterien werden kommerziell in Anwendungen wie elektrischen Drohnen und zur Belieferung einer Automobilfirma eingesetzt.
- Serienreife: Obwohl es sich derzeit noch nicht um Grossserien handelt, ist der Markteintritt der Technologie vorbereitet.
Dual-Chemistry-Architektur, bei der Zellen mit extrem hoher Dichte nur für Langstreckenfahrten aktiviert werden.
Die von dem chinesischen Akku-Giganten CATL vorgeschlagene Dual-Chemistry-Architektur (auch als „Dual-Power-Architektur“ bezeichnet) ist ein innovatives Konzept, um die Vorteile verschiedener Batteriezellchemien in einem einzigen Akkupack zu vereinen und deren Nachteile auszugleichen.
1. Beschreibung der Dual-Chemistry-Architektur.
Die Dual-Chemistry-Batterie besteht aus einem Akkupack, das in zwei verschiedene Zonen aufgeteilt ist, die jeweils unterschiedliche Zellchemien nutzen.
Bestandteile des Akkupacks:
- Zone 1: Herkömmliche Zellen: Diese Zone läuft mit gängigen Lithium-Ionen-Zellen oder sogar Natrium-Ionen-Zellen. Dazu gehören zum Beispiel NMC-Zellen oder LFP-Zellen (Lithiumeisenphosphat).
- Zone 2: Hochdichte Zellen: Diese Zone enthält die neuen anodenfreien Zellen.
2. Die spezielle Aktivierungsstrategie für anodenfreie Zellen.
Das Kernprinzip dieser Architektur ist die gezielte Nutzung der Zellen, um die Lebensdauerprobleme der Hochleistungskomponenten zu umgehen:
- Alltagsbetrieb: Die herkömmlichen Zellen (NMC oder LFP) sollen für Alltagsfahrten genutzt werden. Diese Zellen punkten durch ihre hohe Langlebigkeit.
- Langstreckenbetrieb (Aktivierung der Hochdichte-Zellen): Die anodenfreien Zellen werden hingegen nur für lange Fahrten aktiviert, wenn viel zusätzliche Reichweite benötigt wird.
- Vermeidung vorschneller Alterung: Durch das Abschalten im Alltag soll die vorschnelle Alterung der anodenfreien Zellen unterbunden werden. Die begrenzte Lebensdauer dieser Zellen soll somit für die selteneren Langstrecken ausreichen.
- CATL zufolge soll diese Architektur eine stabilere und zuverlässigere Stromversorgung für Fahrzeuge bieten. Das Konzept wird als eine Art Akku mit Range-Extender Akku oder als reinelektrischer Hybrid beschrieben.
3. Kritik an dem Konzept.
Trotz der Vorteile, die sich CATL von dieser "Dual-Power-Architektur" erhofft, äussern sich Experten skeptisch:
- Kostenproblem: Die Kosten der anodenfreien Zellen bleiben weiterhin hoch und werden die Gesamtkosten des Akkupacks belasten.
- Kalendarische Alterung: Anodenfreie Zellen altern auch kalendarisch – das heisst, sie altern einfach mit der Zeit, selbst wenn sie nicht genutzt werden. Dies ist ein Problem, das die Abschaltstrategie nicht vollständig lösen kann.
- Eignung: Die Technologie ist möglicherweise eher für Anwendungen geeignet, die eine sehr hohe Energiedichte, aber keine zwingend hohe Lebensdauer erfordern, wie zum Beispiel Drohnen.
- Skeptische Einschätzung: Das Konzept der anodenfreien Batterien in E-Autos wird von manchen Experteb als PR-Stunt betrachtet, von dem man in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht viel hören wird.
Recycling-Prozesse für Autobatterien - langfristige Sicherung der Rohstoffe und die Verbesserung der Nachhaltigkeit.
Das Recycling von Autobatterien ist ein zentrales Element zur langfristigen Sicherung der Rohstoffe und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Batteriewertschöpfungskette. Das ultimative Ziel ist es, die Metalle aus gebrauchten Batterien zurückzugewinnen.
Strukturierte Beschreibung der Recycling-Prozesse, der Rohstoffsicherung und der wirtschaftlichen Aspekte, basierend auf den vorliegenden Quellen:
1. Die Rolle des Recyclings und die Sicherung der Rohstoffe.
Das Recycling von Batterien ist aus mehreren Gründen essenziell:
- Liefersicherheit und Volumensicherung: Eine starke Recycling-Wertschöpfungskette in den jeweiligen Ländern, insbesondere in Europa, schafft Liefersicherheit und hilft, die Volumina der Rohstoffe abzusichern.
- Preisabsicherung: Durch die Rückgewinnung der Metalle können sich Unternehmen auch gegen Preisausschläge auf dem Metallmarkt absichern.
- Nachhaltigkeitsverbesserung: Das Recycling verbessert als positiver Nebeneffekt die Nachhaltigkeit der Batterie noch einmal deutlich.
- Regulatorische Vorgaben: Künftig werden steigende Recyclingquoten von der EU für Zellhersteller und Autofirmen vorgeschrieben.
2. Recycling-Prozesse und Rückgewinnung der Metalle.
Der Prozess der Rückgewinnung von Metallen aus Altbatterien beginnt mit der Verarbeitung zu sogenannter Schwarzmasse:
Herstellung der Schwarzmasse (Erster Schritt):
1. Materialquelle: Als Rohmaterial dienen entweder gebrauchte Batteriepacks aus verunfallten oder am Lebensende angelangten Autos oder Produktionsabfall von Zellherstellern, der nicht den Spezifikationen entspricht.
2. Verarbeitung: Diese Materialien werden in Schwarzheide geschreddert und zur sogenannten Schwarzmasse verarbeitet.
3. Aufkonzentration: Die Schwarzmasse ist eine Aufkonzentration der werthaltigen Metalle, die Nickel, Kobalt und Lithium enthält.
Aufschliessen und Raffinerie (Zweiter Schritt).
Nach der Herstellung der Schwarzmasse folgt die Trennung in die einzelnen Wertstoffe:
- Aktuelle Praxis: Derzeit wird die Schwarzmasse durch Spezialfirmen weiter aufgeschlossen, um die Einzelkomponenten (Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan) zurückzugewinnen.
- Zukunftspläne: Wenn der Markt für Altbatterien gross genug ist (hinsichtlich der Volumina), werden verschiedene Unternehmen Metallraffinerien aufbauen, um die Schwarzmasse selbst weiter zu verarbeiten.
- Einspeisung ins Produkt: Aktuell fliessen die Metalle aus der Schwarzmasse noch nicht direkt in die Kathodenmaterialien, da Precursoren, das heisst Vorläuferstoffe, die in verschiedenen chemischen und biologischen Prozessen als Ausgangsmaterialien dienen, um komplexere Substanzen zu erzeugen, am Markt zugekauft werden.
3. Wirtschaftlichkeit und Ausbeute.
Die Wirtschaftlichkeit des Recyclingbetriebs hängt stark von der Batteriezellchemie und den erreichbaren Ausbeuten ab:
Einfluss der Zellchemie (Werthaltigkeit).
- NCM/NCA (Nickel-Kobalt-Chemien): Recycling ist hier wirtschaftlicher, da Lithium, Nickel und Kobalt als werthaltige Stoffe rezykliert werden können.
- LFP (Lithiumeisenphosphat): Das Recycling von LFP ist viel schwieriger, wirtschaftlich zurückzuführen, da die Schwarzmasse am Ende letztlich nur noch Lithium als werthaltigen Stoff enthält.
Technische und wirtschaftliche Ausbeuten.
Die Rückgewinnungsrate wird durch die Wirtschaftlichkeit begrenzt:
- Technisch mögliche Ausbeute: Rein technisch sind Ausbeuten von bis zu 99 % möglich.
- Wirtschaftliche Obergrenze: Der Aufwand, um 99 % zu erreichen, lässt die Wirtschaftlichkeit des Prozesses kippen. Man muss den "Sweet Spot" finden, der den besten wirtschaftlichen Nutzen bringt.
Sinnvolle Ausbeutebereiche:
Ein sinnvoller Bereich der Rückgewinnung liegt bei:
- 96 bis 97 % für Nickel und Kobalt.
- 93 bis 94 % für Lithium.
Seltene Erden - welches sind die 17 chemischen Elemente?
Die sogenannten Seltenen Erden (SEE), deren korrekter Name Seltenerdmetalle lautet, umfassen insgesamt 17 chemische Elemente des Periodensystems. Sie setzen sich zusammen aus der Gruppe der Lanthanoide sowie den Metallen Scandium und Yttrium. Diese 17 Elemente werden üblicherweise in leichte und schwere Seltene Erden unterteilt. Die schweren Seltenen Erden gelten als seltener, sind schwerer aufzubereiten und dadurch teurer.
Liste der 17 chemischen Elemente der Seltenen Erden:
Leichte Seltene Erden:
Scandium
Lanthan
Cer (engl.: Cerium)
Praseodym
Neodym
Promethium
Samarium
Europium
Yttrium
Schwere Seltene Erden:
Gadolinium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thulium
Ytterbium
Lutetium
Wichtiger Hinweis:
Die Seltenen Erden sind entgegen ihrem Namen überwiegend nicht selten und kommen teilweise so häufig vor wie Kupfer. Sie werden jedoch nicht in den Akkus von Elektroautos verwendet, sind aber unverzichtbar für die Dauermagnete in den Elektromotoren.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis.
Mythos: Seltene Erden sind in den Akkus von Elektroautos enthalten.
1. Seltene Erden (SEE) sind nicht in Akkus von Elektroautos.
Immer wieder hört man, dass Seltene Erden (SEE) in Akkus von Elektroautos enthalten sind. Das ist aber nicht so:
- Kein Bestandteil in Akkus: Seltene Erden sind nicht in den Batteriezellen von Elektroautos (E-Autos) enthalten, wie oft fälschlicherweise angenommen wird.
- Abgrenzung zu anderen Rohstoffen: Die Materialien in den E-Auto-Akkus sind Metalle wie Lithium, Aluminium, Kobalt, Kupfer, Silizium und Graphit, die nicht zu den Seltenen Erden zählen.
2. Unverzichtbarkeit für die E-Mobilität: Der Elektromotor.
Obwohl seltene Erden nicht im Akku enthalten sind, sind sie für die E-Mobilität unverzichtbar:
- Verwendung in Elektromotoren: Seltene Erden werden in vielen E-Auto-Modellen im Antriebsmotor verwendet.
- Dauermagnete: Sie sind notwendig für die Herstellung starker Dauermagnete (Permanentmagnete) im E-Motor. Diese Magnete wandeln den Strom in Bewegungsenergie um.
- Wichtigstes SEE (Neodym): Die wichtigste Seltene Erde aus Sicht der Automobilhersteller ist Neodym. Neodym-Magnete zählen zu den stärksten Magneten der Welt.
- Gewicht und Leistung: Der Vorteil des Einsatzes von SEE liegt darin, dass sie leistungsstark sind, aber nur wenig Gewicht mit sich bringen, was einen klaren Pluspunkt für Elektrofahrzeuge darstellt. Ein einziger Elektromotor benötigt bis zu drei Kilogramm Neodym.
3. Alternative SEE-Verwendung im E-Auto und strategische Alternativen.
Obwohl die Dauermagnete der Hauptanwendungsfall sind, gibt es weitere Berührungspunkte und strategische Überlegungen:
- Andere seltene Erden in Motoren: Im Antriebsmotor kommen neben Neodym auch Dysprosium, Praseodym und Terbium zum Einsatz.
- Batterielegierungen: Seltene Erden können auch für die Batterien von Hybrid- und vollelektrischen Fahrzeugen verwendet werden, da eine Metalllegierung für die Elektrode zum Einsatz kommt, die auch SEE wie Lanthan und Neodym enthalten kann.
- Verzicht auf Seltene Erden (SEE): Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Preis, Versorgungssicherheit und des ökologischen Images verzichten Autohersteller zunehmend auf SEE in ihren Motoren. Beispiele wie der BMW iX3, i4 oder iX, der Renault Zoe und der Nissan Ariya kommen ohne Neodym aus.
- Motortypen: Motoren mit Dauermagneten (permanenterregte Motoren, die Neodym nutzen) haben Effizienzvorteile, während fremderregte Motoren (die ohne Neodym auskommen) besser „segeln“ können.
Seltene Erden sind auch essentiell für Windkraftanlagen (Dysprosium, Neodym, Praseodym, Terbium), Photovoltaik, Elektronik und sogar Katalysatoren in Verbrennerautos.
4. Anwendungen der Seltenen Erden (SEE):
1. Verwendung in Windkraftanlagen
Seltene Erden sind essentiell für die Erzeugung regenerativer Energie:
- Dauermagnete im Generator: SEE werden in den Generatoren von Windturbinen eingesetzt, um die Bewegungsenergie der Rotoren in elektrische Energie umzuwandeln.
- Vorteile der Bauweise: Der Einsatz von SEE ermöglicht den Bau äusserst leistungsfähiger Dauermagnete, wodurch kein Getriebe mehr nötig ist. Die Anlagen sind dadurch wartungsärmer und leiser.
- Wichtige Elemente: Für Windkraftanlagen werden in der Regel vor allem Dysprosium, Neodym, Praseodym und Terbium verwendet.
- Marktentwicklung: Neben der Elektromobilität zählt die Windenergie zu den Hauptgründen für die steigende Nachfrage nach Seltenen Erden. Allerdings wurden auch Modelle entwickelt, die ohne SEE (zum Beispiel mit Elektromagneten) auskommen, um die Lieferabhängigkeiten und die Umweltbelastungen zu reduzieren.
2. Verwendung in der Photovoltaik (PV).
Auch im Bereich der Solartechnik tragen Seltene Erden zur Effizienzsteigerung bei:
- Erhöhung der Effizienz: Seltene Erden dienen als Aktivatoren, die die optisch aktiven Glaskeramiken anpassen können. Dadurch wird das einfallende Licht so verändert, dass der für die Solarzellen nutzbare Energiebereich verschoben wird. Die Folge ist eine höhere Lichtausbeute und eine gesteigerte Effizienz.
- Materialvorteile: Sie ermöglichen es, Solarzellen dünner herzustellen, was Materialkosten senkt und die Integration in weitere Anwendungen erleichtert.
- Stabilität: SEE verbessern die Stabilität der Solarzellen und gewährleisten die Leistungsfähigkeit auch bei extremen Temperaturen.
- Wichtige Elemente: Neodym und Erbium haben sich hier als nützlich erwiesen.
3. Verwendung in Katalysatoren und Verbrennerautos.
- Entgegen dem Mythos, dass SEE nur für E-Autos relevant seien, sind sie seit Langem in konventionellen Fahrzeugen verbaut:
- Katalysatoren und Russfilter: Seltene Erden stecken in den Katalysatoren und Russfiltern von Benziner und Diesel-Autos.
- Marktanteil: Katalysatoren machen mit 17,1 % den zweitwichtigsten Einsatzbereich von SEE aus (nach Dauermagneten mit 44,3 %).
- Wichtige Elemente: Zum Beispiel wird das SEE Cer in Katalysatoren und Lanthan in Filtern eingesetzt.
4. Verwendung in der Elektronik und weiteren Technologien.
Seltene Erden sind aus zahlreichen modernen Konsum- und Industrieprodukten nicht mehr wegzudenken:
- Breites Anwendungsspektrum: Sie stecken in Plasma-Fernsehern, Röntgengeräten, Festplatten und Kopfhörern. Auch in Leuchtstoffröhren und LED-Lampen.
- Unabdingbar: Ohne Seltene Erden gäbe es weder Computerchips noch Handys.
- Wasserstoffwirtschaft: Sie werden auch zur Herstellung von grünem Wasserstoff im Rahmen der Wasserelektrolyse benötigt. Hierfür kommen unter anderem Scandium, Yttrium, Cer, Lanthan und Gadolinium zum Einsatz. Angesichts geplanter Ausbauten der Wasserstoffwirtschaft wird die Nachfrage in diesem Sektor weiter steigen.
- Allgemeine Vorteile: Die Metalle werden in all diesen Anwendungen eingesetzt, da sie leistungsstark und leicht sind.
Seltene Erden - geopolitische Abhängigkeit von Europa ist hoch.
China dominiert den Abbau (ca. 68% der Weltproduktion) und die Weiterverarbeitung (fast 90% Marktanteil). Die geopolitische Abhängigkeit Europas und der Welt von China im Bereich der Seltenen Erden (SEE) ist in der Tat sehr hoch und wird durch die Quellen bestätigt.
1. Chinas Dominanz bei Abbau und Produktion.
Die Volksrepublik China hält eine marktbeherrschende Stellung bei der Gewinnung und Aufbereitung von Seltenen Erden:
- Weltproduktion (Abbau): China ist das wichtigste Erzeugerland. Schätzungen zufolge stammten 2024 fast 70 % der Seltenen Erden aus China. Aktuelle Statistiken (Stand 2025) nennen einen Anteil von 68,5 % Chinas an der Weltproduktion Seltener Erden.
- Weiterverarbeitung: Chinas Dominanz ist bei der Weiterverarbeitung sogar noch ausgeprägter. Der Marktanteil Chinas an der Weiterverarbeitung Seltener Erden liegt bei knapp 90 %. In vielen Fällen mangelt es anderen produzierenden Ländern an den Kapazitäten, um die gewonnenen Rohstoffe selbst weiterzuverarbeiten (z.B. Oxide), sodass diese zur Endverarbeitung nach China transportiert werden, von wo die fertigen Produkte (wie Dauermagnete) wieder importiert werden.
- Beispiel Autosektor: Die Europäische Autoindustrie bezieht beispielsweise etwa 98 Prozent seiner Dauermagnete aus Seltenen Erden aus China.
2. Geopolitische Auswirkungen und Preisgestaltung.
Diese Dominanz hat direkte geopolitische Konsequenzen für die Versorgungssicherheit:
- Quasi-Monopol und Preispolitik: China verfügt über ein Quasi-Monopol auf wichtige Rohstoffe, einschliesslich der Seltenen Erden. Das Land weiss um seine starke Stellung und zieht dementsprechend Nutzen daraus. China treibt den Weltmarktpreis für die Metalle schon seit 2010 in die Höhe.
- Zynisches Spiel: In der Vergangenheit hat China zunächst Dumping betrieben, um andere Länder aus dem Geschäft zu drängen. Als Quasi-Monopolist wurde dann mit einer Verknappung gedroht, um die Preise hochzutreiben (z.B. für Neodym auf 230 Franken).
3. Historische und Ökologische Faktoren der Dominanz.
Die Stellung Chinas konnte historisch auch durch niedrige Standards gefestigt werden:
- Umweltkosten: China baute seine Stellung als grösster SEE-Lieferant zulasten der Umwelt und der Menschen aus. Während im Westen strenge Auflagen gelten, sind in China Unmengen teils radioaktiver Giftschlämme in der freien Natur gelandet, was Dumpingpreise ermöglichte.
4. Europas Reaktion auf die Abhängigkeit.
Angesichts dieser kritischen Abhängigkeit reagiert die Europäische Union (EU):
- Kritische Rohstoffe: Die EU stuft Seltene Erden als kritische Rohstoffe ein.
- CRMA: Mit dem im Mai 2024 in Kraft getretenen „Critical Raw Materials Act“ (CRMA) will die EU die Versorgungssicherheit stärken.
- Ziele: Das Ziel ist es, bis 2030 zehn Prozent des Bedarfs an strategischen Rohstoffen durch Bergbau innerhalb der EU zu gewinnen.
- Entdeckung in Lappland: Grosse Hoffnungen ruhen auf dem Vorkommen „Per Gejer“ in Lappland (Schweden), das mit über einer Million Tonnen das grösste bisher entdeckte SEE-Vorkommen in Europa sein soll. Allerdings wird die Erschliessung voraussichtlich 10 bis 15 Jahre dauern.
- Recycling: Eine weitere Strategie ist der Aufbau von Recyclingkapazitäten, um den Bedarf aus Sekundärquellen zu decken. Anlagen wie die Magnet-Recyclinganlage in Bitterfeld (eröffnet Mai 2024) sollen dabei helfen.
Recycling von Seltenen Erden (SEE).
Das Recycling von Seltenen Erden steckt noch in den Anfängen (aktuell nur etwa 1% Recyclingquote), ist aber technisch mit pyrometallurgischen oder hydrometallurgischen Verfahren möglich. Europa baut hier Kapazitäten auf, wie die Magnet-Recyclinganlage in Bitterfeld.
1. Aktueller Stand und geringe Recyclingquote.
Anfänge des Recyclings: Das Recycling von Seltenen Erden steckt momentan noch in den Anfängen.
- Aktuelle Quote: Es überrascht daher nicht, dass derzeit gerade mal ein Prozent der Seltenerdmetalle tatsächlich recycelt wird.
- Herausforderungen: Dies liegt daran, dass es zurzeit keine Programme gibt, die die Gestaltung des Recyclings von SEE aus bereits hergestellten Produkten regeln. Zudem sind die bestehenden Technologien weder ausgereift genug für eine praktische Anwendung, noch sind sie wirtschaftlich.
2. Technische Machbarkeit und mögliche Verfahren.
Obwohl die Umsetzung in der Praxis schwierig ist, ist das Recycling von SEE technisch möglich:
- Theoretisches Potenzial: Laut Forschungsergebnissen könnten theoretisch bis zu 99,8 Prozent der Seltenen Erden durch Recycling zurückgewonnen werden.
- Gängige Verfahren: Die gängigen Methoden des Recyclings, die zur Anwendung kommen, sind:
- Pyrometallurgie: Bei diesem Verfahren wird das Material eingeschmolzen, um Seltene Erden und andere Metalle zu trennen. Allerdings ist dieses Verfahren energieintensiv, und es werden Schadstoffe freigesetzt.
- Hydrometallurgie: Bei diesem Verfahren werden die Seltenen Erden mithilfe von chemischen Lösungsmitteln extrahiert. Dies gilt als die umweltschonendere Variante der beiden, vorausgesetzt, die Abwasserbehandlung wird ordnungsgemäss durchgeführt.
- Forschung: Biohydrometallurgie: Erforscht wird zudem die Biohydrometallurgie. Hierbei werden Metalle mithilfe von Mikroorganismen und Bakterien aus mineralischen Verbindungen herausgelöst.
3. Vorteile des Recyclings.
Das Recycling von SEE bietet deutliche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz:
- Energieersparnis: Für die Rückgewinnung von Neodym aus alten Magneten wird nur ein Drittel der Energie benötigt, die für den erneuten Abbau und die Herstellung notwendig wäre.
- Umweltschutz: Die Menge an freigesetzten Schadstoffen ist beim Recycling geringer als bei der Primärgewinnung.
4. Aufbau von Kapazitäten in Europa.
Europa hat die Notwendigkeit erkannt, eigene Recyclingkapazitäten aufzubauen, um die Abhängigkeit zu reduzieren:
- Magnet-Recyclinganlage Bitterfeld: Europas grösste Recycling-Anlage für Magnete mit Seltenen Erden wurde im Mai 2024 in Bitterfeld (Deutschland) eröffnet.
- Strategische Bedeutung: Da Dauermagnete (die Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium, Praseodym und Terbium enthalten) das grösste Anwendungsgebiet für Seltene Erden darstellen (44,3 % des Einsatzbereichs), ist dieser Bereich besonders lohnend für das Recycling.
- EU-Ziele: Die Europäische Union (EU) plant, dass bis 2030 15 Prozent des Bedarfs an Seltenen Erden aus Sekundärquellen (Recycling) stammen sollen. Um dies zu erreichen, könnte es zukünftig die Pflicht zur Rücknahme von E-Auto-Batterien oder Dauermagneten geben, ähnlich wie beim Elektroschrott.
Kann auf seltene Erden verzichtet werden?
Die Frage, ob auf Seltene Erden (SEE) vollständig verzichtet werden kann, muss differenziert betrachtet werden. Generell gelten diese 17 Elemente als unabdingbar für weite Teile der modernen Industrie und Zukunftstechnologien. Dennoch zeigen die Quellen, dass in einigen kritischen Anwendungsbereichen, insbesondere in der Elektromobilität, bereits erfolgreich auf sie verzichtet wird.
1. Verzicht in der E-Mobilität (Elektromotoren).
Der wichtigste Einsatzbereich von Seltenen Erden ist die Herstellung von Dauermagneten in Elektromotoren. Hier ist ein Verzicht bereits Realität, angetrieben durch strategische und ökologische Überlegungen:
- Verfügbare Alternativen: Es ist möglich, Elektromotoren zu bauen, die ohne Seltene Erden (insbesondere ohne Neodym) auskommen.
- Beispiele von Herstellern: Mehrere Automobilhersteller setzen bereits auf diese SEE-freien Lösungen:
- Der BMW iX3 nutzt weder Neodym noch andere Seltene Erden.
- Auch Modelle wie der BMW i4 oder iX, der Renault Zoe und der Nissan Ariya kommen ohne Neodym aus.
- Technologische Alternative: Der Verzicht wird durch den Einsatz fremderregter Motoren möglich.
- Technologische Kompromisse:
- Permanenterregte Motoren (die Neodym nutzen) haben tendenziell Effizienzvorteile.
- Fremderregte Motoren (ohne Neodym) können unter bestimmten Bedingungen besser "segeln" (rollen ohne Energieverbrauch).
- Gründe für den Verzicht: Die Hersteller motivieren den Verzicht hauptsächlich aus Gründen der Preis- und Versorgungssicherheit (aufgrund der Marktbeherrschung Chinas) und vor allem wegen des Ökologie-Image.
2. Verzicht in der Windenergie.
Auch im Bereich der erneuerbaren Energien gibt es Entwicklungen, die auf Seltene Erden verzichten:
- Alternativen in Generatoren: In den Generatoren von Windkraftanlagen sind SEE für leistungsstarke Dauermagnete nötig. Allerdings wurden mittlerweile auch Modelle entwickelt, für die keine Seltenen Erden mehr nötig sind, beispielsweise wenn Elektromagneten zum Einsatz kommen.
- Ziel des Verzichts: Der Vorteil dieser SEE-freien Bauweise liegt darin, dass die Lieferabhängigkeiten und die Umweltbelastungen geringer ausfallen.
3. Indispensabilität in anderen Technologiebereichen.
In vielen anderen zentralen Anwendungsbereichen gelten Seltene Erden jedoch weiterhin als unabdingbar:
- Elektronik: Ohne Seltene Erden gäbe es weder Computerchips noch Handys. Sie stecken ebenfalls in Festplatten, Kopfhörern, Leuchtstoffröhren und LED-Lampen.
- Katalysatoren: Sie sind seit Langem in Katalysatoren und Russfiltern von Verbrenner-Autos verbaut.
- Photovoltaik: Hier dienen sie als Aktivatoren zur Erhöhung der Lichtausbeute und Effizienz der Solarzellen.
- Wasserstoffwirtschaft: Sie sind für die Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff erforderlich.
4. Strategische Reduktion durch Recycling.
Ein vollständiger Verzicht auf SEE ist derzeit in vielen Sektoren nicht absehbar. Die Reduktion der Abhängigkeit vom Primärabbau wird daher durch den Aufbau von Recycling-Kapazitäten forciert, was die Notwendigkeit des Abbaus reduziert:
- Technische Machbarkeit: Das Recycling von SEE ist technisch möglich, beispielsweise durch pyrometallurgische oder hydrometallurgische Verfahren.
- Qualität: Recycelte Neodym-Magnete sind 96 Prozent so gut wie neue.
- Energieeffizienz: Für die Rückgewinnung von Neodym wird nur ein Drittel der Energie benötigt, die für den erneuten Abbau nötig wäre.
- Ausbau in Europa: Anlagen wie die Magnet-Recyclinganlage in Bitterfeld (eröffnet Mai 2024) werden in Europa aufgebaut, um zukünftig den Bedarf (die EU strebt 15 Prozent des Bedarfs aus Sekundärquellen bis 2030 an) zumindest teilweise über Recycling zu decken.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis.
Übersicht Batterie-Themen.
Batterietechnik, Zellchemien, Cell-to-Pack, Trockenbeschichtung, Energiedichte, stationäre Energiespeicher, Netzstabilität. Innovative Speichertechnologien, Effizienz Batteriespeicher, Materialbasis, Innovationen in Zellchemie und -design.
Übersichtsseiten mit Inhaltsverzeichnissen.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Quellen (Oktober 2025).
Batterienaterialien und -Recycling.
https://m.youtube.com/watch?v=xC2gsJoGVLo&pp=ygUMZW5lcmdpZXdlbmRl
Anodenfreie Batterien.
https://m.youtube.com/watch?v=6_bGaTp4Mmk
Erstes Auto mit Feststoff-Akku.
https://m.youtube.com/watch?v=jUjRn1r9h48
Und weitere Quellen.