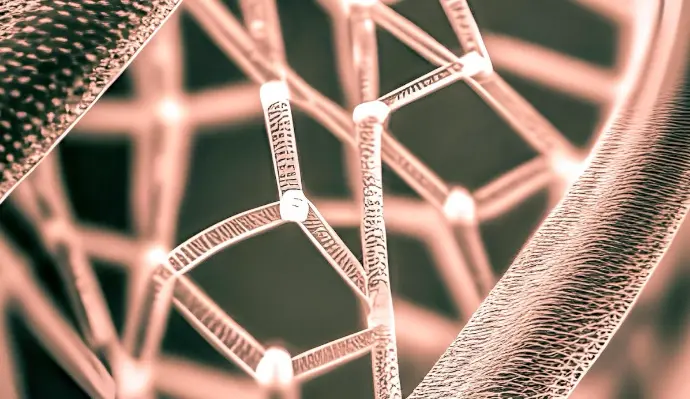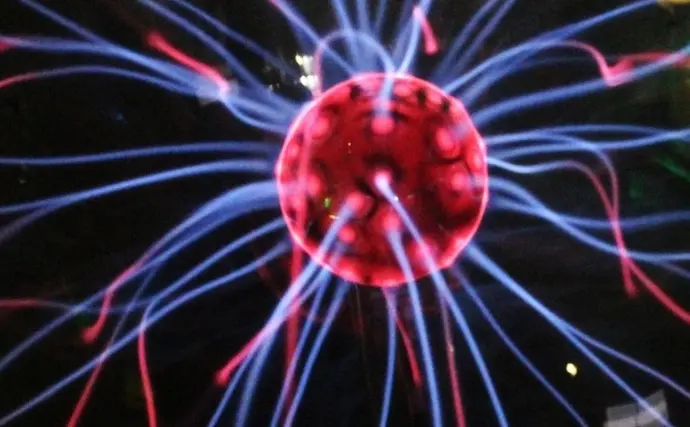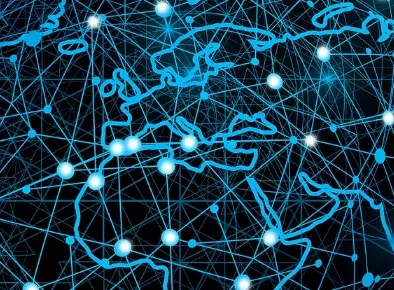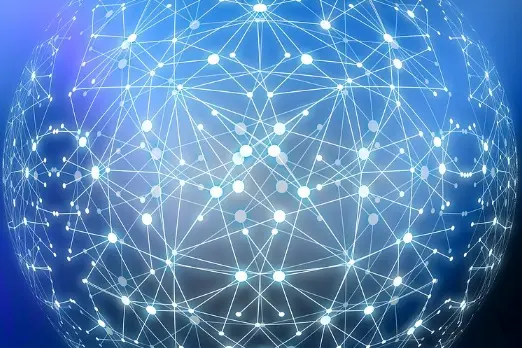Elektrofahrzeuge deutlich effizienter als E-Fuels: E-Methan, E-Methanol, E-Diesel/Kerosin/Benzin, E-Ammoniak.
18.9.2025
Hier geht es um die Herstellung, Anwendungen und der öffentlichen Wahrnehmung von E-Kraftstoffen und um die Rohstoffe und Produktionswege für verschiedene E-Kraftstofftypen wie E-Methan, E-Methanol, E-Diesel/Kerosin/Benzin und E-Ammoniak. Es werden auch die technologische Reife und die Umweltauswirkungen dieser synthetischen Kraftstoffe, einschliesslich ihres Potenzials zur Kohlenstoffreduzierung und ihrer Vergleichbarkeit mit Elektrofahrzeugen untersucht. Ferner wird die Wahrnehmung von Risiken durch die Öffentlichkeit in Bezug auf E-Kraftstoffe und andere Antriebsarten analysiert und die Bedeutung der Wahrnehmung für die Akzeptanz nachhaltiger Mobilitätslösungen hervorgehoben. Schliesslich werden laufende Forschungs- und Produktionsinitiativen von Unternehmen und Automobilherstellern sowie politische Empfehlungen für eine breitere Einführung von E-Kraftstoffen beleuchtet.
Was sind E-Fuels?
Sind E-Fuels die Zukunft der Mobilität oder ein falsches Versprechen?
In einer Welt, die dringend nach nachhaltigen Energielösungen sucht, gewinnen E-Fuels (Elektrokraftstoffe) zunehmend an Aufmerksamkeit. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, wie werden sie hergestellt und welches Potenzial bergen sie für eine klimafreundlichere Zukunft? Dieser Blogbeitrag beleuchtet die wichtigsten Aspekte rund um E-Fuels.
E-Fuels - synthetische Kraftstoffe.
E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mit elektrischer Energie hergestellt werden. Sie werden auch als kohlenstoffneutrale synthetische Kraftstoffe bezeichnet und bieten eine potenzielle Lösung zur Reduzierung des CO2-Fussabdrucks, der mit herkömmlichen fossilen Brennstoffen verbunden ist. Der entscheidende Unterschied zu fossilen Brennstoffen ist, dass E-Fuels kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre freisetzen, wenn sie verbrannt werden, da das bei der Produktion aufgenommene CO2 wieder emittiert wird. Damit sind sie in der Gesamtbilanz klimaneutral.
E-Fuels ähneln in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften stark konventionellen flüssigen oder gasförmigen Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Kerosin. Dies ist ein bedeutender Vorteil, da sie ohne wesentliche Änderungen in bestehenden Verbrennungsmotoren und Infrastrukturen (wie Tankstellen, Raffinerien, Pipelines) eingesetzt werden können – sie sind sogenannte „Drop-in“-Kraftstoffe.
Wie werden E-Fuels hergestellt?
Die Produktion von E-Fuels ist ein mehrstufiger Prozess, der im Wesentlichen auf drei Hauptrohstoffen basiert: erneuerbarem Strom, Wasser und einer Kohlenstoffquelle (CO2 oder CO) oder Stickstoff (N2).
1. E-Wasserstoff-Produktion:
Der Ausgangspunkt ist immer E-Wasserstoff (E-H2), der durch Wasserelektrolyse hergestellt wird. Bei diesem Prozess wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff (H2) und Sauerstoff zerlegt, wofür viel Strom benötigt wird. Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, muss dieser Strom ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen stammen. Die derzeit am weitesten verbreiteten Elektrolysetechnologien sind alkalische Elektrolysezellen (AEC) und Protonenaustauschmembran-Technologien (PEM), während Festoxid-Elektrolysezellen (SOEC) in der Entwicklung sind und Effizienzvorteile bei hohen Temperaturen bieten.
2. Kohlenstoff- oder Stickstoffquelle:
CO2-Abscheidung:
Das benötigte Kohlendioxid kann aus Industrieprozessen (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS) oder direkt aus der Luft (Direct Air Capture, DAC) gewonnen werden. CCUS-Technologien können 85–95 % des CO2 aus Kraftwerken abscheiden, sind aber energieintensiv. DAC-Technologien fangen CO2 aus der Umgebungsluft ein, was aufgrund der geringen CO2-Konzentration in der Luft eine Herausforderung darstellt, aber mehrere Technologien (Absorption/Elektrodialyse, Absorption/Kalzinierung, Adsorption/Desorption) werden entwickelt. DAC wird voraussichtlich an Bedeutung gewinnen, wenn die CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen sinken.
Stickstoffgewinnung:
Für E-Ammoniak wird Stickstoff (N2) aus der Atmosphäre gewonnen, hauptsächlich durch kryogene Destillation, Membrantrennung oder Druckwechseladsorption. Kryogene Destillation ist hierbei die kostengünstigste Methode.
3. Syntheseprozesse:
Der erzeugte Wasserstoff wird dann mit der Kohlenstoffquelle oder Stickstoff kombiniert, um verschiedene E-Fuel-Arten zu synthetisieren:
- E-Methan: Hergestellt durch Methanisierung von CO2 mit Wasserstoff in der Sabatier-Reaktion.
- E-Methanol: Durch katalytische Hydrierung von CO2 mit Wasserstoff.
- E-DME/OME: Dimethylether (DME) kann durch Dehydratisierung von Methanol oder direkt aus Synthesegas hergestellt werden. OMEx sind Oligomere von DME.
- E-Diesel/Kerosin/Benzin (PtL-Anwendungen): Diese flüssigen Kraftstoffe werden typischerweise über das Fischer-Tropsch-Verfahren (FT) aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid (gewonnen aus CO2 über die Reverse-Wassergas-Shift-Reaktion) oder aus Methanol als Zwischenprodukt (Methanol-to-Gasoline (MTG) oder Methanol-to-Olefin-to-Gasoline and Diesel (MOGD)) hergestellt.
- E-Ammoniak: Durch die Reaktion von Wasserstoff mit Stickstoff, typischerweise im Haber-Bosch-Verfahren.
Vorteile von E-Fuels.
Klimaneutralität: Bei Produktion mit erneuerbarem Strom und recyceltem CO2 stossen E-Fuels bei der Verbrennung theoretisch keine zusätzlichen Treibhausgase aus.
Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur: E-Fuels können in der vorhandenen Infrastruktur für Transport, Lagerung und Verteilung genutzt werden, was grosse Investitionen in den Umbau von Systemen und Fahrzeugen überflüssig macht.
Einsatz in schwer zu elektrifizierenden Sektoren: Besonders vielversprechend sind E-Fuels für Sektoren wie den Schwerlastverkehr (LKW), die Luftfahrt und die Schifffahrt, wo direkte Elektrifizierung kurz- bis mittelfristig schwierig oder nicht praktikabel ist und hohe Energiedichten gefragt sind.
Energiespeicher: E-Fuels können als Mittel zur langfristigen Speicherung elektrischer Energie in chemischer Form dienen und so die Variabilität erneuerbarer Energiequellen ausgleichen.
Reduzierung lokaler Schadstoffe: Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen enthalten E-Fuels keinen Schwefel und stossen daher keine Schwefeloxide (SOx) aus, was die lokale Umweltverschmutzung reduziert.
Herausforderungen und Nachteile
Geringe Energieeffizienz:
Die Produktion von E-Fuels ist sehr energieintensiv. Von der Elektrizität bis zum Endkraftstoff gehen etwa 60 % der Energie verloren. Bei der Nutzung im Verbrennungsmotor gehen weitere ca. 70 % verloren, was zu einer Gesamteffizienz von Strom zu Nutzenergie von nur etwa 10–35 % führt. Dies ist zwei- bis vierzehnmal höher als bei direkten Elektrifizierungsalternativen. Ein batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) benötigt etwa fünfmal weniger Strom für die gleiche Strecke als ein E-Fuel-betriebenes Auto.
Hohe Produktionskosten:
E-Fuels sind deutlich teurer in der Herstellung als fossile Brennstoffe oder elektrische Alternativen. Die Kosten hängen hauptsächlich von den Stromkosten ab, und bei aktuellen Strompreisen sind E-Fuels nicht wettbewerbsfähig. Auch die CO2-Abscheidung, insbesondere DAC, ist teuer. Prognosen zeigen zwar einen Rückgang der Kosten bis 2050 (1-3 EUR pro Liter ohne Steuern), doch ist dafür massive politische Unterstützung und Subventionen erforderlich
Welche Arten von E-Fuels gibt es und was sind deren Vor- und Nachteile?
E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mit elektrischer Energie hergestellt werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ihre Nachhaltigkeit hängt entscheidend davon ab, ob Wasserstoff und Strom aus erneuerbaren Quellen stammen und die Kohlenstoffquelle nachhaltig gewonnen wird.
E-Wasserstoff (E-H2).
Definition und Herstellung:
E-Wasserstoff ist grüner Wasserstoff, der durch die Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird, idealerweise unter Verwendung von erneuerbarem Strom. Gängige Elektrolysetechnologien sind alkalische Elektrolysezellen (AEC), Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM) und Festoxid-Elektrolysezellen-Technologie (SOEC).
Vorteile:
- Gilt als potenziell CO2-frei, wenn er aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird.
- Kann einen sehr reinen H2-Strom (über 99,99 %) erzeugen, der für Brennstoffzellen wichtig ist.
- Ist ein attraktiver Energieträger mit einem unteren Heizwert von 120 MJ/kg.
- Kann in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung für Industrie und Transport genutzt werden.
- Kann zur Senkung der CO2-Intensität bis zu einem Massenanteil von 15 % direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden.
- Ist ein notwendiger Rohstoff für die Herstellung aller anderen E-Kraftstoffe.
- Die Produktionskosten werden voraussichtlich nachhaltiger und erschwinglicher mit zunehmender Verfügbarkeit und Kostensenkung erneuerbarer Energien.
Nachteile:
- Transport und Lagerung stellen aufgrund der geringen Volumendichte eine grosse Herausforderung dar.
- Speicherung von komprimiertem Wasserstoff erfordert die sorgfältige Auswahl von Materialien zur Vermeidung von Korrosion.
- Verflüssigung bei -253 °C erfordert kontinuierlichen Energieeintrag.
- Hohe Entflammbarkeit und Flammentemperatur können bei direkter Verbrennung zu hohen NOx-Werten führen und erfordern Änderungen an Brennkammern.
- Die Verbreitung als Kraftstoff ist aufgrund der Komplexität der Kraftstoffverteilung und der erforderlichen Tankinfrastruktur noch sehr begrenzt.
- Mangel an dedizierter Infrastruktur (Transport- und Speicherinfrastruktur).
- Hohe Produktionskosten, eng verbunden mit Stromkosten und Elektrolyseur-Effizienz.
E-Methan.
Definition und Herstellung:
Synthetisches Methan, das durch die Methanisierung von CO2 mit E-Wasserstoff hergestellt wird. Dabei reagiert Wasserstoff mit Kohlendioxid (Sabatier-Reaktion) bei hohen Temperaturen und Drücken. Das CO2 kann aus CCUS-Techniken (Carbon Capture Utilization and Storage) oder direkter Abscheidung aus der Luft (DAC) stammen.
Vorteile:
- Kann in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden.
- Kann als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge sowie in industriellen Anwendungen und zur Stromerzeugung genutzt werden.
- Ermöglicht die Speicherung von erneuerbarem Strom in chemischer Form.
- Trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, wenn erneuerbarer Strom und CO2 genutzt werden.
- Geringere Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu anderen Kohlenwasserstoffbrennstoffen.
Nachteile:
- Methanemissionen müssen sorgfältig kontrolliert werden, da Methan ein hohes Treibhauspotenzial (GWP100) von 28 kg CO2 pro kg CH4 aufweist.
- Erfordert erhebliche Mengen an CO2 (5,5 kg pro kg H2), das aufgrund der Entfernung zwischen den CO2-Abscheidungssystemen und den Anlagen für erneuerbare Energien schwierig zu beschaffen sein kann, was die Transportkosten erhöht.
- Graues und braunes Methan aus fossilen Quellen sind derzeit wirtschaftlicher.
E-Methanol.
Definition und Herstellung:
Methanol, das aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Die Herstellung erfolgt durch katalytische Hydrierung von CO2 mit Wasserstoff bei hohen Temperaturen und Drücken unter Verwendung von Katalysatoren auf Cu/Zn/Al-Basis. CO2 kann aus Industrieemissionen oder direkt aus der Luft stammen.
Vorteile:
- Kann aus verschiedenen Kohlenstoffquellen gewonnen werden, einschliesslich Erdgas, Kohle, Biomasse und CO2.
- Wird zur Herstellung einer Vielzahl von Chemikalien verwendet (z. B. Formaldehyd, Dimethylether).
- Dient als Lösungsmittel und sauberer synthetischer Kraftstoff für Transport, Industriekessel, Abwasserbehandlung und Stromerzeugung.
- Kann zur Herstellung von Derivaten wie Dimethylether (DME), synthetischem Benzin oder Kerosin verwendet werden.
- Hat eine hohe Oktanzahl und niedrige Cetanzahl, wodurch es sich mit minimalen Modifikationen für Ottomotoren eignet.
- Demonstrationsanlagen sind bereits weltweit in Betrieb.
Nachteile:
- Die volumetrische Energiedichte beträgt etwa die Hälfte der von Benzin.
- Ein Grossteil der weltweiten Methanolproduktion stammt derzeit aus fossilen Brennstoffen (85 % aus Erdgas, 15 % aus Kohle).
- Nur ein sehr kleiner Teil (0,2 %) stammt aus erneuerbaren Quellen.
- Die direkte Umwandlung aus E-Methan befindet sich noch in der frühen Entwicklungsphase (5 bis 20 Jahre bis zur industriellen Machbarkeit).
E-DME/OME (Dimethylether/Oxymethylenether).
Definition und Herstellung:
DME ist der einfachste Ether und OMEx sind Oligomere davon. DME wird hauptsächlich durch die Dehydratisierung von Methanol in einem zweistufigen Prozess (CO2-Reduktion zu Methanol, dann Methanol-Dehydratisierung zu DME) hergestellt. Es kann auch direkt aus Synthesegas über den Fischer-Tropsch-Prozess synthetisiert werden. Die RWGS-Reaktion kann CO aus CO2 gewinnen.
Vorteile:
- Relativ einfach zu handhaben; kann leicht verflüssigt und bei niedrigem Druck gelagert werden, ähnlich wie Flüssiggas (LPG).
- Hat eine höhere volumetrische Energiedichte, was es für Verbrennungsmotoren attraktiv macht.
- Verursacht im Vergleich zu Diesel deutlich geringere CO2-Emissionen und reduziert Schadstoffe (NOx, SOx und Feinstaub) im Motorabgas.
- Wird als Alternative zu Diesel für den Einsatz in Selbstzündungsmotoren angesehen.
- Leicht zu transportieren und zu lagern.
- Wird in kleinen Nutzfahrzeugflotten (Busse, Schwerlastfahrzeuge) zur Verbesserung der Luftqualität eingesetzt.
Nachteile:
- Die geringe Oktanzahl stellt eine Herausforderung für den Einsatz als LPG-Gemisch in Ottomotoren dar.
- Erfordert geringfügige Änderungen am Motor und Einspritzsystem sowie eine spezielle Neukalibrierung des Motors.
- Die direkte Verwendung in Brennstoffzellen befindet sich noch in einem frühen Laborstadium.
- OMEx sind nicht mit bestehenden Infrastrukturen und aktuellen europäischen Dieselspezifikationen kompatibel und erfordern bei hohen Konzentrationen eine vollständige Anpassung von Motor und Kraftstoffsystem.
E-Diesel/Kerosin/Benzin (PtL-Anwendungen).
Definition und Herstellung:
Synthetische Flüssigkraftstoffe (Diesel, Kerosin, Benzin), die oft als Power-to-Liquid (PtL) bezeichnet werden. Sie nutzen in der Regel Wasserstoff und Kohlenmonoxid als Rohstoffe, um über das Fischer-Tropsch-Verfahren (FT) flüssige Kraftstoffe zu erzeugen. Alternativ können sie Methanol als Zwischenprodukt nutzen und es durch Verfahren wie Methanol-to-Gasoline (MTG) oder Methanol-to-Olefin-to-Gasoline and Diesel (MOGD) umwandeln.
Vorteile:
- Sind den konventionellen fossilen Kraftstoffen chemisch sehr ähnlich und daher als „Drop-in“-Kraftstoffe ohne Modifikationen in bestehenden Verbrennungsmotoren und Tankstellennetzen verwendbar.
- E-Diesel ist von Natur aus schwefelfrei.
- E-Kerosin zeichnet sich durch seine hohe Energiedichte und Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur und Flugzeugtriebwerken aus. Es kann die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren.
- Transport und Lagerung sind nicht besonders problematisch, da die bestehende Infrastruktur genutzt werden kann.
- Haben ein erhebliches Potenzial zur Dekarbonisierung in den Sektoren Luftfahrt, Schifffahrt und Schwerlastverkehr, wo direkte Elektrifizierung schwierig ist.
Nachteile:
- Der Effizienzfaktor für die E-Diesel-Produktion durch den FT-Prozess ist niedriger als bei anderen E-Kraftstoff-Produktionsprozessen.
- Die Nachhaltigkeit hängt von der Rohstoffquelle (erneuerbarer Strom und CO2-Abscheidung) ab.
- Die Produktionsmenge von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), zu dem E-Kerosin gehört, ist im Vergleich zu herkömmlichem Flugkraftstoff noch vernachlässigbar.
E-Ammoniak.
Definition und Herstellung:
Ammoniak (NH3), das unter Verwendung von grünem Wasserstoff hergestellt wird. Die Produktion erfolgt durch die Reaktion von H2 mit Stickstoff (N2, gewonnen aus der Atmosphäre) mittels des Haber-Bosch-Verfahrens.
Vorteile:
- Lässt sich bei einem sehr niedrigen Druck (ca. 1 MPa) leicht in flüssiger Form lagern, ohne spezielle Hochdrucktanks zu erfordern.
- Gilt als potenzieller Energieträger und Wasserstofftransportvektor aufgrund seiner hohen Wasserstoffdichte und der Fähigkeit, unter moderaten Bedingungen verflüssigt zu werden.
- Die Produktionskosten sind zwar etwas höher als die von Wasserstoff, aber Transport- und Lagerkosten sind deutlich niedriger, was Ammoniak für die Energiespeicherung vorteilhafter macht.
- Vielversprechend als Kraftstoff für Brennstoffzellen der nächsten Generation aufgrund seiner hohen Energiedichte und kohlenstofffreien Emissionen (bei Produktion mit grünem Wasserstoff).
- Kann Gasturbinen, Industrieöfen oder Verbrennungsmotoren antreiben.
Nachteile:
- Der Grossteil der Ammoniakproduktion (ca. 98 %) stammt derzeit aus fossilen Brennstoffen.
- Verluste bei der vollständigen Dehydrierung zur Erzeugung von reinem Wasserstoff sind erheblich.
- Die für eine weit verbreitete Nutzung als Kraftstoff erforderliche Infrastruktur befindet sich noch in der Entwicklung.
- Erfordert hohe Temperaturen (500–700 °C) für die Zersetzung in Stickstoff und Wasserstoff, was die Systemgestaltung erschwert.
- Ammoniak ist giftig und ätzend, was Risiken bei Handhabung und Lagerung birgt, die sorgfältig gemanagt werden müssen.
- Aktuelle Katalysatoren in Ammoniak-Brennstoffzellen neigen zu Zersetzung und Vergiftung, was Effizienz und Lebensdauer verringert.
- Bei der Verbrennung von Ammoniak wird eine grosse Menge NOx freigesetzt.
- Ammoniakverluste in Boden, Luft und Wasser können zu Biodiversitätsverlust, Eutrophierung, Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen und Ozonabbau führen.
- Gilt derzeit als unsicher für den Strassentransport.
Allgemeine Vor- und Nachteile von E-Fuels.
Vorteile von E-Fuels (allgemein):
- Klimaneutralität: E-Fuels sind (nahezu) klimaneutral, wenn sie ausschliesslich mit erneuerbarem Strom und nachhaltig gewonnenem H2 hergestellt werden und das CO2 als Rohstoff genutzt wird. Das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 entspricht dann in etwa dem bei der Produktion gebundenen CO2.
- Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur: Sie können nahtlos in die vorhandene Infrastruktur für Transport, Speicherung und Verteilung von fossilen Brennstoffen integriert werden (z. B. Tankstellen, Raffinerien, Pipelines). Dies spart Investitionen in den Umbau von Systemen und Technologien.
- Drop-in-Fähigkeit: Sie können in bestehenden Verbrennungsmotoren und Heizungen ohne wesentliche Änderungen verwendet werden.
- Speichermedium für erneuerbare Energien: E-Fuels können als effektives Mittel zur Speicherung elektrischer Energie in chemischen Bindungen dienen, wodurch die Variabilität der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen ausgeglichen werden kann.
- Reduzierung lokaler Schadstoffe: E-Fuels stossen keine Schwefeloxide (SOx) aus, da sie keine Schwefelverbindungen enthalten. Sie können auch die Luftqualität verbessern.
- Unabhängigkeit und Diversifizierung: Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen erfordert die E-Fuel-Produktion keine spezifischen geografischen Bedingungen für die Primärressourcen und kann somit zur Diversifizierung der Energieimporte beitragen.
- Anwendungen in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren: Besonders vielversprechend sind E-Fuels für Sektoren, die nicht direkt elektrifizierbar sind, wie den Langstrecken-Luft- und Seeverkehr sowie den Schwerlastverkehr.
- Brückenlösung: Können dazu beitragen, die Zeit zu überbrücken, bis Elektrofahrzeuge weiter verbreitet sind und die Elektrifizierung in allen Sektoren abgeschlossen ist.
Nachteile von E-Fuels (allgemein):
- Geringe Energieeffizienz: E-Fuels sind keine primäre Energiequelle, sondern ein sekundärer Energieträger. Die Produktion und Nutzung sind mit erheblichen Umwandlungsverlusten verbunden (z. B. etwa 60 % Verluste bei der Umwandlung von Strom in Kohlenwasserstoff-Kraftstoff, und weitere 70 % des verbleibenden Energiegehalts gehen bei der Nutzung in Verbrennungsmotoren verloren).
- Hoher Strombedarf: Sie benötigen zwei- bis vierzehnmal mehr Strom als direkte Elektrifizierungsalternativen. Ein Auto mit E-Kraftstoffen benötigt etwa fünfmal mehr erneuerbare Elektrizität als ein vergleichbares batterieelektrisches Fahrzeug (BEV).
- Kosten: E-Fuels sind derzeit deutlich teurer in der Herstellung als fossile Brennstoffe oder elektrische Alternativen (heute bis zu 7 EUR pro Liter). Ihre Wettbewerbsfähigkeit hängt von politischen Massnahmen und Subventionen ab.
- Klimawirksamkeit nur bei grünem Strom: Wenn E-Fuels mit dem derzeitigen Strommix vieler Länder hergestellt würden, würden sie die Treibhausgasemissionen erhöhen, nicht senken. Es ist ein Anteil von 90–100 % erneuerbarem Strom für eine tatsächliche Emissionsreduktion erforderlich.
- Noch geringer Reifegrad und Skalierungsprobleme: Viele E-Fuel-Technologien befinden sich noch in einem niedrigen kommerziellen Entwicklungsstand und sind trotz hoher technologischer Reife oft noch nicht kommerziell nutzbar. Es sind erhebliche Investitionen und der Aufbau grosser erneuerbarer Energiekapazitäten erforderlich, um eine grosstechnische Produktion zu ermöglichen.
- Fehlende Industriestandards: Es mangelt derzeit an umfassenden Industriestandards für Transport, Lagerung und Nutzung von E-Fuels, was deren Integration in bestehende Energiesysteme behindert.
- Konkurrenz zu direkter Elektrifizierung: Im Leichtverkehr sind E-Fuels gegenüber batterieelektrischen Fahrzeugen nicht wettbewerbsfähig. Die direkte Elektrifizierung ist aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht oft sinnvoller.
- Risiko der Verlängerung fossiler Abhängigkeit: Das Festhalten an Verbrennungstechnologien in der Hoffnung auf E-Fuels könnte dazu führen, dass weiterhin Öl und Gas verbrannt werden, falls E-Fuels zu kostspielig und knapp bleiben, was kurz- und langfristige Klimaziele gefährdet.
Welche Bedeutung hat Wasserstoff im Zusammenhang mit E-Fuels?
Wasserstoff (H2) ist von zentraler Bedeutung für die Herstellung von E-Fuels und wird in den Quellen als deren Ausgangsmaterial beschrieben. E-Fuels, auch als synthetische oder elektrizitätsbasierte Kraftstoffe bekannt, sind kohlendioxidneutrale synthetische Kraftstoffe, die durch die Reaktion von Wasserstoff mit einer Kohlenstoffquelle (CO2 oder CO) oder Stickstoff (N2) hergestellt werden.
Ausgangsstoff für E-Fuel-Produktion:
E-Wasserstoff (E-H2), der durch die Elektrolyse von Wasser unter Verwendung von erneuerbarem Strom hergestellt wird, ist der grundlegende Ausgangsstoff für alle anderen E-Fuels.
Diese Methode gilt als potenziell CO2-frei, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.
Die Nachhaltigkeit von E-Fuels hängt entscheidend davon ab, wie der verwendete Wasserstoff und Strom erzeugt werden und wie die Kohlenstoffquelle beschafft wird.
Produktion von E-Wasserstoff:
Die Elektrolyse spaltet Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff.
Drei Haupttechnologien für die Elektrolyse sind:
Alkalische Elektrolysezellen (AEC): Bewährt und weit verbreitet, produzieren hochreinen E-H2 zu relativ niedrigen Anfangskosten, können aber Korrosion verursachen und sind weniger geeignet für schwankenden Energiebedarf. AEC ist derzeit die am weitesten verbreitete Technologie.
Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM): Hocheffizient und kann variable Lastprofile erneuerbarer Energiequellen verarbeiten, erfordert aber teure Elektrodenmaterialien.
Festoxid-Elektrolysezellen-Technologie (SOEC): Sehr effizient bei hohen Temperaturen, insbesondere in Verbindung mit Hochtemperatur-Wärmequellen. Jüngste Fortschritte haben die Kosten gesenkt und die Haltbarkeit verbessert.
Wasserstoff als Rohstoff für verschiedene E-Fuel-Typen:
- E-H2 kann direkt als E-Kraftstoff verwendet werden.
- Es kann mit CO2 zu E-Methan (durch die Sabatier-Reaktion), E-Methanol, E-DME/OME oder E-Diesel/Kerosin/Benzin synthetisiert werden.
- Es kann auch mit Stickstoff (N2) zu E-Ammoniak kombiniert werden. N2 wird dabei aus der Atmosphäre gewonnen, zum Beispiel durch kryogene Destillation.
Wasserstoff als Energieträger und Kraftstoff:
Wasserstoff ist ein attraktiver Energieträger mit einem hohen unteren Heizwert (LHV) von 120 MJ/kg.
Er kann Brennstoffzellen (BZ) versorgen, um Strom für industrielle und Transportzwecke zu erzeugen. Dies stellt eine direkte Konkurrenz zu batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) dar.
Wasserstoff kann auch in das Erdgasnetz eingespeist werden (bis zu 15 % Massenanteil), um dessen CO2-Intensität zu senken.
Direkte Verbrennung von Wasserstoff ist möglich, erfordert jedoch oft Änderungen an Brennkammern und kann hohe NOx-Werte verursachen.
Herausforderungen in Bezug auf Wasserstoff:
Speicherung und Transport:
Wasserstoff stellt aufgrund seiner geringen Volumendichte eine grosse Herausforderung für Transport und Lagerung dar. Es gibt verschiedene Methoden wie komprimierten oder verflüssigten Wasserstoff, kryokomprimierten Wasserstoff, Metallhydride, physikalische Adsorption und flüssige organische H2-Träger (LOHCs), sowie die Speicherung in Salzkavernen.
Kosten:
Eine der grössten Herausforderungen bei der Produktion von E-H2 sind die Kosten, die eng mit den Stromkosten und der Effizienz der Elektrolyseure zusammenhängen. Aktuell wird nur ein sehr geringer Anteil (4 %) des gesamten H2 aus erneuerbaren Quellen hergestellt.
Energieintensität:
Die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse ist der energieintensivste Prozess unter allen E-Fuel-Produktionsschritten. Dies erfordert eine erhebliche Steigerung der erneuerbaren Energieerzeugung, um die Treibhausgasemissionsneutralität von E-Fuels zu gewährleisten.
Chancen und Perspektiven:
Trotz der Herausforderungen wird erwartet, dass E-H2 im Laufe der Zeit eine immer wichtigere Rolle spielen wird, da erneuerbare Energien breiter verfügbar und kostengünstiger werden.
Die Produktion von E-Fuels bietet die Möglichkeit, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern.
Ein neuer Bericht des Environmental Defense Fund prognostiziert, dass die Kosten für E-Fuels halbiert werden könnten, wenn sie in einem dynamischen, angebotsgesteuerten Strommarkt produziert werden, was durch die Verfügbarkeit von überschüssigem erneuerbaren Strom (z.B. im Mittleren Westen der USA) ermöglicht wird.
Wasserstoff bildet das Rückgrat der E-Fuel-Produktion und sowohl als direkter Kraftstoff als auch als Schlüsselrohstoff für eine Reihe anderer synthetischer Kraftstoffe dient. Seine Rolle ist entscheidend für die Dekarbonisierung schwer zu elektrifizierender Sektoren wie der Luft- und Schifffahrt sowie des Schwerlastverkehrs. Die breite Einführung von E-Fuels hängt jedoch stark von der Verfügbarkeit kostengünstiger, erneuerbarer Elektrizität und Fortschritten bei der Wasserstoffproduktion und CO2-Abscheidungstechnologien ab.
Welche Arten von Elektrolyse gibt es und wie effizient sind diese?
Wasserstoff (H2) ist das Ausgangsmaterial für die Produktion von E-Fuels, und seine Herstellung durch Elektrolyse ist ein zentraler Schritt. Die Nachhaltigkeit von E-Fuels hängt massgeblich davon ab, dass der für die Wasserstoffproduktion benötigte Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.
Bei der Elektrolyse wird Strom genutzt, um Wassermoleküle in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Derzeit werden nur etwa 4 % des gesamten Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen hergestellt.
Es gibt drei Haupttypen von Elektrolyseuren zur Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse:
Alkalische Elektrolysezellen (AEC):
Beschreibung: AECs sind eine bewährte und weit verbreitete Technologie. Sie verwenden wässrige Elektrolytlösungen (wie Kaliumhydroxid (KOH) oder Natriumhydroxid (NaOH)) und metallische Elektroden, wobei OH–-Ionen zwischen Kathode und Anode übertragen werden. Ein Diaphragma verhindert die Vermischung der entstehenden Gase Wasserstoff und Sauerstoff.
Effizienz/Eigenschaften: AECs können hochreinen E-H2 zu relativ niedrigen Anfangskosten produzieren. Sie können jedoch Korrosion verursachen und benötigen eine gewisse Anlaufzeit, was sie weniger geeignet macht, um Schwankungen im Energiebedarf auszugleichen. Ihre Effizienz ist im Vergleich zu anderen Elektrolyseurtypen geringer, trotz ihrer relativ einfachen und wirtschaftlichen Bauweise. AEC ist derzeit die am weitesten verbreitete Technologie.
Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM):
Beschreibung: Bei dieser Technologie spaltet sich das Wassermolekül an der Anode in Sauerstoff, Elektronen und Protonen (H+). Die Protonen durchqueren eine Elektrolytmembran und erreichen die Kathode, wo sie reduziert werden und E-H2 bilden.
Effizienz/Eigenschaften: Die PEM-Technologie ist ein hocheffizientes Verfahren. Sie kann variable Lastprofile von erneuerbaren Energiequellen verarbeiten, die typischerweise nicht programmierbar sind. Ein Nachteil sind die teuren Elektrodenmaterialien, die die Gesamtsystemkosten erhöhen. Der technologische Reifegrad (TRL) für die PEM-Wasserstoffproduktion wird mit 7 angegeben.
Festoxid-Elektrolysezellen-Technologie (SOEC):
Beschreibung: SOEC verwendet Dampf an der Kathode, um Wasser zu reduzieren, wodurch E-H2 und O2--Anionen entstehen. Diese Anionen bewegen sich zur Anode, wo sich Sauerstoff bildet.
Effizienz/Eigenschaften: Die SOEC-Technologie ist sehr effizient bei hohen Temperaturen. Sie bietet einen potenziellen Vorteil in der Gesamtenergieeffizienz, insbesondere wenn sie in Hochtemperatur-Wärmequellen wie Solarthermie oder industrielle Abwärme integriert wird. Obwohl es früher Bedenken hinsichtlich des hohen Energieverbrauchs und der Kosten gab, haben jüngste Fortschritte in der Materialwissenschaft und technologischen Entwicklung die Kosten gesenkt und die Haltbarkeit sowie Effizienz verbessert, was SOECs zu einer praktikableren Option macht. Der TRL für die SOEC-Wasserstoffproduktion liegt bei 6.
Energieverbrauch und Effizienz der Wasserstoffproduktion:
Die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse ist der energieintensivste Prozess aller E-Kraftstoff-Produktionsschritte. Der Energieverbrauch für die Elektrolyse liegt typischerweise zwischen 45 und 73 kWh/kg(H2).
Die Gesamteffizienz von E-Fuels, definiert als die Umwandlung von Strom in Nutzenergie, variiert je nach Anwendung und Technologie zwischen etwa 10 % und 35 %. Bei der Herstellung von Kohlenwasserstoffen aus Elektrizität gehen derzeit etwa 60 % des Energieeinsatzes verloren, da mindestens zwei Umwandlungsschritte (Elektrolyse und Kohlenwasserstoffsynthese) erforderlich sind. Dies beinhaltet auch den Strombedarf für die CO2-Abscheidung. Bei der Nutzung von E-Fuels in Transportmotoren gehen weitere etwa 70 % des verbleibenden Energiegehalts verloren. Insgesamt erfordert die Verwendung von E-Fuels in einem Verbrennungsmotor eines Personenkraftwagens etwa fünfmal mehr (erneuerbare) Elektrizität als die direkte Nutzung von Elektrizität in einem vergleichbaren batteriebetriebenen Fahrzeug.
Wie hoch ist der Stromverbrauch bei der Elektrolyse?
Der Stromverbrauch für die Wasserstoffproduktion mittels Elektrolyse liegt typischerweise zwischen 45 und 73 kWh pro Kilogramm Wasserstoff (H2). Dieser Prozess ist der energieintensivste Schritt bei der Herstellung von E-Fuels. Nachfolgend werden Herausforderungen beschrieben sowie die erfolgreiche Lösung spezifischer Probleme, die zu einer gesteigerten Effizienz bei der Elektrolyse beigetragen haben, insbesondere bei der Festoxid-Elektrolysezellen-Technologie (SOEC).
Problem:
Frühere Bedenken bei der Festoxid-Elektrolysezellen-Technologie (SOEC) betrafen den hohen Energieverbrauch (impliziert geringere Effizienz) und hohe Kosten.
Lösung/Verbesserung:
Materialwissenschaftliche Fortschritte:
Jüngste Fortschritte in der Materialwissenschaft haben zur Verwendung kostengünstigerer Materialien für Anode, Kathode und Elektrolyt geführt. Dies hat die Gesamtkapitalkosten von SOEC-Systemen gesenkt.
Technologische Entwicklung:
Die technologische Entwicklung von SOECs hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Verbesserungen in der Haltbarkeit und Effizienz machen sie zu einer praktikableren Option im Vergleich zu anderen Elektrolyseurtypen.
Hochtemperatureffizienz und Integration:
SOEC-Technologie ist sehr effizient bei hohen Temperaturen und bietet einen potenziellen Vorteil in der Gesamtenergieeffizienz, besonders wenn sie in Verbindung mit Hochtemperatur-Wärmequellen wie Solarthermie oder industrieller Abwärme integriert wird.
Die Hauptprobleme des hohen Energieverbrauchs und der hohen Kosten bei SOEC wurden durch die Entwicklung kostengünstigerer Materialien und allgemeine technologische Fortschritte in Haltbarkeit und Effizienz erfolgreich angegangen, wodurch SOEC zu einer praktikableren und effizienteren Option geworden ist.
Alkalischen Elektrolysezellen (AEC) sind trotz ihrer einfachen und wirtschaftlichen Bauweise nicht so effizient sind wie andere Elektrolyseurtypen und können Korrosion verursachen. Für die Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM) wird eine hohe Effizienz hervorgehoben und die Fähigkeit, variable Lastprofile zu verarbeiten, aber die teuren Elektrodenmaterialien werden als Nachteil genannt. Bei diesen beiden Technologien wird keine explizite Lösung für eine gesteigerte Effizienz im Sinne einer überwundenen Herausforderung aufgeführt, sondern eher die jeweiligen Eigenschaften oder bestehenden Nachteile im Vergleich zu anderen Typen beschrieben.
Anwendungen von E-Fuels.
E-Fuels bieten eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Sektoren, da sie als vielseitige Energieträger und Rohstoffe dienen können. Ihre Kompatibilität mit bestehenden Infrastrukturen ist ein wesentlicher Vorteil, der ihre Integration erleichtern kann.
Transportsektor (Allgemein).
E-Fuels dienen als wichtige Energievektoren im gesamten Transportsektor. Sie können bestehende Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren antreiben, ohne dass wesentliche Änderungen erforderlich sind ("Drop-in"-Kraftstoffe). Sie bieten eine Lösung zur Dekarbonisierung des Verkehrs, insbesondere dort, wo eine direkte Elektrifizierung kurz- bis mittelfristig nicht praktikabel ist.
Strassenverkehr:
Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge:
Einsatz in konventionellen und Hybrid-Gas-, Diesel- und Benzinmotoren als Ersatz oder Beimischung. Sie können die Zeit bis zur weiteren Verbreitung von Elektrofahrzeugen überbrücken.
Schwerlastverkehr (LKW):
Eine praktikable Lösung für die Dekarbonisierung von LKW, insbesondere für den Langstrecken-Strassentransport, wo elektrische Alternativen kurzfristig fehlen. E-Diesel ist hier eine vielversprechende Option.
Erdgasfahrzeuge:
E-Methan kann als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge genutzt werden.
Zweiräder:
Es wird ein Potenzial für den Einsatz von E-Benzin gesehen.
Off-Road-Bereich und Baumaschinen:
Einsatz in Baumaschinen und im Off-Road-Sektor, wo es noch keine sinnvolle technische Alternative gibt.
Luftfahrt:
Flugzeugtreibstoff (E-Kerosin / SAF): E-Kerosin wird hauptsächlich als Flugzeugtreibstoff verwendet und kann die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren. Es wird oft mit bestehenden Kerosin-Treibstoffen gemischt.
Schifffahrt:
Schiffsantrieb: E-Ammoniak, E-Methanol und E-Diesel werden für ihre Anwendung in der Schifffahrt, insbesondere für den Schwerlastseetransport, als vielversprechend angesehen.
Wärmemarkt / Heizungsanwendungen:
Gebäude und Industrie: E-Fuels können in Heizungen eingesetzt werden, die flüssige und gasförmige Brennstoffe nutzen, einschliesslich Ölheizungen und Industriekessel. Sie können sowohl für Nieder- (<100 °C) als auch für Hochtemperatur-Wärmebereitstellung (>100 °C) in industriellen Anwendungen genutzt werden.
Industrie (als Rohstoff und Energiequelle):
Chemische Industrie: E-Methan, E-Methanol und E-Ammoniak können als Rohstoffe für die Synthese verschiedener chemischer Substanzen dienen, wie Kunststoffe, Kunstfasern, Harze, Kältemittel und Sprengstoffe. Methanol wird zur Herstellung von Formaldehyd, Dimethylether und Methyl-Tertiär-Butylether (MTBE) verwendet, während DME auch in Dimethylsulfat (DMS) umgewandelt werden kann.
Düngemittelproduktion:
Ammoniak findet hauptsächlich in der landwirtschaftlichen Düngemittelindustrie Anwendung.
Stahlproduktion:
E-Fuels sind für die Dekarbonisierung der Stahlproduktion unverzichtbar.
Allgemeine industrielle Anwendungen:
E-Fuels können in verschiedenen Industrieprozessen und Industrieöfen eingesetzt werden.
Anlagenbetrieb:
E-Fuels können im regulären Betrieb von Anlagen verwendet werden, um Produkte gleicher Qualität mit weniger schädlichen Auswirkungen zu liefern.
Stromerzeugung und Energiespeicherung:
Stromerzeugung:
E-Fuels können zur Stromerzeugung in Gasturbinen oder thermoelektrischen Kraftwerken eingesetzt werden.
Energiespeicherung:
E-Fuels können überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen in chemischer Form speichern, um ihn bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Sie dienen als Mittel zur langfristigen Energiespeicherung und zur Stabilisierung des Stromnetzes.
Brennstoffzellen:
Wasserstoff (H2) und Ammoniak können zur Versorgung von Brennstoffzellen genutzt werden, um vor Ort Strom zu erzeugen.
Erdgasnetz-Einspeisung:
Wasserstoff und E-Methan können bis zu einem bestimmten Anteil direkt in das bestehende Erdgasnetz eingespeist werden, um dessen CO2-Intensität zu senken.
E-Fuels im Wärmemarkt als Ersatz für Heizöl, Gas und andere Wärmequellen.
E-Autos, E-Lastwagen, E-Schiffe, E-Flugzeuge und E-Motorräder, die direkt mit Strom betrieben werden, sind in jedem Fall deutlich effizienter als Verbrenner der gleichen Gattung, die mit E-Fuels betrieben werden.
Die höhere Effizienz von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen, die mit E-Fuels betrieben werden, liegt in den erheblichen Energieverlusten während der Herstellung und Nutzung von E-Fuels. Bei der Umwandlung von Elektrizität in Kohlenwasserstoff-Kraftstoff gehen bereits etwa 60 % der Energie verloren, was auch den Strombedarf für die CO2-Abscheidung beinhaltet. Wenn der verbleibende Energiegehalt des E-Fuels in einem Verbrennungsmotor oder einer Gasturbine für mechanische Arbeit genutzt wird, gehen weitere etwa 70 % der Energie verloren. Der Gesamtwirkungsgrad von Strom zu Nutzenergie liegt bei E-Fuels, je nach Anwendung und Technologie, nur zwischen etwa 10 % und 35 %. Elektrofahrzeuge hingegen benötigen zwei- bis vierzehnmal weniger Strom als die entsprechenden E-Fuel-Alternativen.
Die Nachhaltigkeit von E-Fuels hängt entscheidend davon ab, dass der benötigte Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt und das CO2 aus nachhaltigen Quellen gewonnen wird. Würden E-Fuels mit dem durchschnittlichen europäischen Strommix von 2021 hergestellt, würden sie höhere Treibhausgasemissionen verursachen als fossile Brennstoffe (dreimal so hoch wie fossile Brennstoffe).
Zukunft für E-Fuels im Wärmemarkt.
E-Fuels können prinzipiell im Wärmemarkt als Ersatz für Heizöl, Gas und andere Wärmequellen eingesetzt werden, insbesondere in bestehenden Heizsystemen für Gebäude und Industrie.
Niedertemperaturheizungen (<100 °C):
Anwendung: Können in bestehenden Heizsystemen in Gebäuden und Industrie eingesetzt werden. Es gibt etwa 20 Millionen Heizungen in der EU, die konventionelle flüssige und gasförmige Brennstoffe nutzen und für die E-Fuels eine klimaneutrale Lösung bieten könnten.
Effizienz:
E-Fuels sind bei der Erzeugung von Niedertemperaturwärme etwa halb so effizient wie Wärmepumpen, die direkt Strom nutzen. Der Effizienznachteil ist hauptsächlich auf die Verluste bei der E-Fuel-Produktion zurückzuführen.
Fazit:
Die Herstellung dieser Kraftstoffe als breiter Ersatz für fossile Brennstoffe zum Heizen von Häusern ist zu ineffizient, kostspielig und ihre Verfügbarkeit zu ungewiss.
Hochtemperatur-Wärmeversorgung (>100 °C):
Anwendung:
Hauptsächlich für industrielle Anwendungen, insbesondere in Prozessen, die sich kaum direkt elektrifizieren lassen. E-Fuels können in Industrieöfen eingesetzt werden.
Effizienz:
Wärmepumpen können Strom sehr effizient direkt nutzen und erreichen einen Leistungskoeffizienten (COP) von mehr als 2, was zu Energieeffizienzen führt, die 6- bis 14-mal höher sind als bei der Verwendung von E-Kraftstoffen. Obwohl Heizkessel effizient sind, sind die Herstellung von E-Kraftstoffen in verschiedenen Umwandlungsphasen mit erheblichen Energieverlusten verbunden.
Fazit:
Auch wenn die Effizienzlücke bei Hochtemperatur-Wärmeversorgung geringer ist als bei Niedertemperatur-Anwendungen, schneiden elektrische Technologien insgesamt immer noch besser ab als E-Kraftstoffe.
Sonstige Einsatzmöglichkeiten für E-Fuels.
Über den Verkehrssektor und den Heizungsmarkt hinaus könnten E-Fuels in verschiedenen anderen Bereichen eingesetzt werden:
Chemische Industrie:
E-Methan, E-Methanol und E-Ammoniak können als Rohstoffe für die chemische Industrie dienen. Methanol wird zur Herstellung von Chemikalien wie Formaldehyd, Dimethylether und MTBE sowie als Lösungsmittel verwendet. Ammoniak wird hauptsächlich für Düngemittel, aber auch für Kunststoffe, Kunstfasern, Harze, Kältemittel und Sprengstoffe verwendet. Auch Stickstoff, ein Bestandteil von Ammoniak, findet breite Anwendung in der chemischen, Landwirtschafts-, Lebensmittel- und metallurgischen Industrie.
Energiespeicher:
E-Fuels können als Mittel zur Speicherung elektrischer Energie in chemischen Bindungen dienen. Dies ist vorteilhaft, um die Variabilität der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu handhaben und die Herausforderung der langfristigen Energiespeicherung zu lösen, die mit aktuellen Batterietechnologien schwierig ist. Sie können konventionell produzierte Kraftstoffe bei Versorgungsschwankungen ersetzen.
Industrielle Prozesse:
Neben der Hochtemperaturwärmeversorgung können E-Fuels auch in Industrieöfen oder zur Stromerzeugung eingesetzt werden.
Off-Road-Bereich/Baumaschinen:
Für Bereiche, in denen derzeit keine sinnvolle technische Alternative als Antriebsmittel besteht.
Stromerzeugung:
E-Methan und E-Methanol können zur Stromerzeugung genutzt werden. DME kann in thermoelektrischen Kraftwerken eingesetzt werden.
Haben E-Fuels als Ersatz für Diesel, Benzin und Kerosin eine Chance?
E-Fuels haben das Potenzial, eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung des Verkehrs zu spielen, insbesondere in Sektoren, die schwer direkt zu elektrifizieren sind. Ihre Nachhaltigkeit hängt jedoch entscheidend davon ab, dass der benötigte Strom ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen stammt. Derzeit sind sie aufgrund hoher Produktionskosten und des enormen Bedarfs an erneuerbarem Strom noch nicht umfassend wettbewerbsfähig.
Strassenverkehr (Benzin und Diesel).
Personenkraftwagen (E-Benzin / E-Diesel):
Chance:
Gering. Obwohl E-Fuels als „Drop-in“-Kraftstoffe in bestehenden Verbrennungsmotoren (Benzin- und Dieselmotoren) verwendet werden können, ohne Änderungen an Fahrzeugen oder Infrastruktur, sind sie im Vergleich zu batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) deutlich weniger effizient. Ein Pkw mit E-Fuels benötigt etwa fünfmal mehr erneuerbare Elektrizität als ein vergleichbares BEV. Dies führt zu höheren Kosten und Emissionen, wenn der Strom nicht zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammt. Analysen im Leichtverkehr zeigen, dass E-Kraftstoffe nicht wettbewerbsfähig sind. E-Fuels werden eher als Übergangslösung angesehen, um die Zeit bis zur vollständigen Elektrifizierung zu überbrücken.
Schwerlastverkehr (LKW) (E-Diesel, E-Methanol, E-LNG, E-Ammoniak):
Chance:
Gut bis hoch für bestimmte E-Fuels.
E-Diesel wird als einer der vielversprechendsten und nachhaltigsten E-Kraftstoffe für den Schwerlastsektor angesehen. Er kann nahtlos in bestehende Dieselmotoren integriert werden und hat das Potenzial, die Treibhausgasemissionen um bis zu 85 % zu senken, wenn er aus erneuerbaren Quellen stammt.
E-Methanol und E-LNG sind ebenfalls attraktive Optionen für LKW, insbesondere bei niedrigen CO2-Kosten.
E-Ammoniak gilt derzeit als unsicher für den Strassentransport aufgrund von Risiken bei der Verbrennung (NOx-Emissionen), Toxizität bei der Handhabung und technischen Herausforderungen bei der Kommerzialisierung als Kraftstoff.
Begründung:
Für den Schwerlastverkehr, insbesondere im Langstreckentransport, fehlen kurz- bis mittelfristig praktikable elektrische Alternativen, was E-Fuels zu einer gangbaren Lösung für die Dekarbonisierung macht.
Luftfahrt (Kerosin).
E-Kerosin (Sustainable Aviation Fuel - SAF):
Chance:
Sehr hoch und entscheidend. E-Kerosin gilt als der realisierbarste E-Kraftstoff für die Luftfahrt. Der Sektor ist schwer direkt elektrifizierbar, und für Langstreckenflüge gibt es keine direkte Elektro- oder Wasserstoffoption.
Vorteile:
Es bietet eine hohe Energiedichte und ist mit der bestehenden Infrastruktur und Flugzeugtriebwerken kompatibel. E-Kerosin kann die Treibhausgasemissionen erheblich reduzieren (bis zu 99 % bei vollständiger Produktion aus erneuerbaren Quellen).
Herausforderungen:
Die Produktionsmengen sind derzeit noch vernachlässigbar im Vergleich zum Bedarf, und die Produktionskosten sind hoch.
Ausblick:
Eine massive Ausweitung der Produktion wird angestrebt, um die Klimaziele zu erreichen. Die USA schätzen, dass E-Fuels bis 2050 den Grossteil oder die gesamte Nachfrage nach Flugbenzin decken könnten.
Schifffahrt (Diesel, Methanol, Ammoniak).
E-Ammoniak, E-Methanol, E-Diesel, E-LNG:
Chance:
Hoch. Die Schifffahrt ist, ähnlich wie die Luftfahrt, ein Sektor, der sich nur schwer direkt elektrifizieren lässt und daher auf kraftstoffbasierte Lösungen angewiesen ist.
Vorteile:
E-Ammoniak, E-Methanol und E-Diesel sind für ihre geringen Emissionen und etablierten Anwendungen in der Schifffahrt bekannt. E-Ammoniak wird insbesondere für sein Potenzial zur Reduktion der THG-Emissionen hervorgehoben und ist als Wasserstoffträger für den Schwerlastseetransport attraktiv, da es unter moderaten Bedingungen verflüssigt und gespeichert werden kann. E-Methanol, E-Diesel und E-LNG sind ebenfalls interessante Optionen, besonders bei niedrigen CO2-Kosten.
Herausforderungen:
Für E-Ammoniak und E-DME/OME sind neue Systeme für Transport und Lagerung sowie Änderungen an den Nutzungstechnologien erforderlich, da sie derzeit nicht als Kraftstoffe verwendet werden.
Allgemeine Herausforderungen und Voraussetzungen für die Chancen von E-Fuels:
Energieeffizienz:
Die Herstellung von E-Fuels ist mit erheblichen Energieverlusten verbunden. Etwa 60 % des Energieeinsatzes gehen bei der Umwandlung von Elektrizität in Kohlenwasserstoffkraftstoff verloren (einschliesslich CO2-Abscheidung). Weitere 70 % des verbleibenden Energiegehalts gehen bei der Umwandlung in mechanische Arbeit in Transportmotoren verloren. Dies führt zu einem Gesamtwirkungsgrad von Strom zu Nutzenergie von nur etwa 10 % bis 35 %.
Kosten:
E-Fuels sind derzeit deutlich teurer als fossile Brennstoffe (2,5- bis 4-mal). Die Kosten hängen stark von den Stromkosten ab. Zwar wird erwartet, dass die Preise bis 2050 auf 1 bis 3 EUR pro Liter (ohne Steuern) fallen könnten, dies erfordert jedoch Skaleneffekte, sinkende Preise für erneuerbare Energien und erhebliche Subventionen und politische Unterstützung.
Verfügbarkeit erneuerbarer Energie:
Die Produktion von E-Fuels erfordert eine massive Erhöhung der Kapazitäten für erneuerbaren Strom. Derzeit stammen nur etwa 4 % des gesamten Wasserstoffs aus erneuerbaren Quellen.
Infrastrukturkompatibilität:
E-Fuels können die bestehende Infrastruktur für fossile Brennstoffe nutzen, was ein grosser Vorteil ist.
CO2-Quelle:
Für die CO2-Neutralität muss das CO2 aus Industrieprozessen (CCUS) oder direkt aus der Luft (DAC) abgeschieden werden. Die DAC-Technologien befinden sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium und sind kostspielig.
Anwendungen:
E-Fuels sind am vielversprechendsten für Sektoren wie Luftfahrt und Schifffahrt, in denen direkte Elektrifizierung derzeit keine praktikable Option darstellt. Für den individuellen Strassenverkehr sind batterieelektrische Fahrzeuge aufgrund ihrer deutlich höheren Energieeffizienz die bevorzugte Lösung. Die breite Akzeptanz und der Erfolg von E-Fuels hängen massgeblich vom massiven Ausbau erneuerbarer Energien, sinkenden Produktionskosten und einer starken politischen Unterstützung ab.
Warum sind E-Autos, E-Lastwagen, E-Schiffe, E-Flugzeuge und E-Motorräder in jedem Fall effizienter mit Strom als Verbrenner der gleichen Gattung mit E-Fuels?
E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die als potenzielle Lösung zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors und anderer Bereiche, die stark von fossilen Brennstoffen abhängig sind, in Betracht gezogen werden. Ihre Rolle im Vergleich zu direkt elektrifizierten Fahrzeugen hängt jedoch stark vom Anwendungsbereich und der zugrunde liegenden Energieeffizienz ab.
Grundlegender Effizienzvergleich (E-Fahrzeuge vs. Verbrenner mit E-Fuels).
Die zentrale Erkenntnis ist, dass E-Fahrzeuge, die direkt mit Strom betrieben werden, in jedem Fall eine deutlich höhere Energieeffizienz aufweisen als Verbrennungsmotoren, die mit E-Fuels betrieben werden.
Tiefe Umwandlungseffizienz von E-Fuels:
- E-Fuels sind keine primäre Energiequelle, sondern sekundäre Energieträger. Ihre Herstellung und Nutzung sind mit erheblichen Energieverlusten durch Umwandlungsprozesse verbunden.
- Bei der Umwandlung von Elektrizität in Kohlenwasserstoff-Kraftstoff gehen etwa 60 % der Energie verloren (inklusive CO2-Abscheidung).
- Weitere 70 % des verbleibenden Energiegehalts des E-Fuels gehen verloren, wenn es für mechanische Arbeit in Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen verwendet wird.
- Dies führt zu einem Gesamtwirkungsgrad von Strom zu Nutzenergie von nur etwa 10 % bis 35 % für E-Fuels, je nach Anwendung und Technologie.
Höhere Effizienz bei direkter Elektrifizierung:
Elektroautos haben wesentlich kürzere Umwandlungsketten, bei denen der Grossteil der elektrischen Energie erhalten bleibt. Dies führt zu einer viel höheren Gesamteffizienz im Betrieb.
Die Nachhaltigkeit von E-Fuels hängt entscheidend davon ab, dass der benötigte Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Würden E-Fuels mit dem durchschnittlichen europäischen Strommix von 2021 hergestellt, würden sie höhere Emissionen verursachen als fossile Brennstoffe (dreimal so hoch wie fossile Brennstoffe bei europäischem Energiemix).
Chancen und Herausforderungen nach Anwendungsgebiet.
Personenkraftwagen (E-Autos).
Effizienz: Ein Pkw mit E-Fuels benötigt etwa fünfmal mehr erneuerbare Elektrizität als ein vergleichbares batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), um denselben Zweck zu erfüllen. Dies ist die grösste Ineffizienz.
Vorteile BEVs:
- Deutlich höhere Energieeffizienz.
- Geringere CO2-Emissionen, selbst mit dem aktuellen Strommix vieler Länder.
- Wachsende Beliebtheit und technologische Fortschritte.
Nachteile BEVs:
- Energieintensive Batterieproduktion, obwohl sich dies durch den Einsatz von Grünstrom bereits verbessert hat.
- Erfordert eine Umrüstung der Infrastruktur (Ladenetze) und des Stromnetzes.
- Diskussionen über Reichweitenangst und Ladezeiten (implizit).
Vorteile E-Fuels für Pkw:
- Können in bestehenden Benzin-, Diesel- oder Hybridmotoren als Ersatz oder Beimischung verwendet werden, ohne Änderungen an Fahrzeugen oder Infrastruktur ("Drop-in"-Kraftstoffe).
- Nutzen bestehendes Tankstellennetz, Raffinerien und Pipelines.
- Überbrückung der Zeit bis zur weiteren Verbreitung von Elektrofahrzeugen.
Nachteile E-Fuels für Pkw:
- Aufgrund der geringeren Effizienz und höheren Kosten sind E-Fuels im Leichtverkehr nicht wettbewerbsfähig und weniger vorteilhaft im Vergleich zur direkten Elektrifizierung.
- Die EU hat die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2035 nur erlaubt, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden, dies wird aber primär Luxus-Supersportwagen zugutekommen.
- Hohe Produktionskosten.
Lastwagen (E-Lastwagen / Schwerlastverkehr).
Effizienz: Elektrische Lkw (z.B. 150 km Reichweite für Stadtverkehr oder 800 km für Langstrecke) können Treibhausgasemissionen pro Tonnenkilometer bei einem Anteil von über 60-65% erneuerbarer Elektrizität reduzieren. Allerdings erfordern Langstrecken-E-LKW grössere Batterien, was die maximale Nutzlast verringern kann.
Vorteile E-Fuels für Lkw:
- Praktikable Lösung für die Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs, insbesondere für den Langstrecken-Strassentransport, wo elektrische Alternativen kurz- bis mittelfristig fehlen.
- E-Diesel gilt als einer der vielversprechendsten und nachhaltigsten E-Kraftstoffe für diesen Sektor, da er nahtlos in bestehende Dieselmotoren und Infrastrukturen integriert werden kann und die Treibhausgasemissionen um bis zu 85 % senken kann, wenn er aus erneuerbaren Quellen stammt.
- E-Methanol und E-LNG sind ebenfalls attraktive Optionen, insbesondere bei niedrigen CO2-Kosten.
Nachteile E-Fuels für Lkw:
- Benötigen hohe Mengen an erneuerbarem Strom.
- E-Ammoniak gilt derzeit als unsicher für den Strassentransport aufgrund von Risiken bei der Verbrennung (NOx-Emissionen), Toxizität und technischen Herausforderungen bei der Kommerzialisierung als Kraftstoff.
Schiffe (E-Schiffe / Schifffahrt).
Effizienz: Die Quellen erwähnen keine direkte Effizienzmessung von elektrischen Schiffen im Vergleich zu E-Fuels, betonen aber, dass die Schifffahrt ein Sektor ist, der sich schwer direkt elektrifizieren lässt.
Vorteile E-Fuels für Schiffe:
- Hohes Potenzial zur Dekarbonisierung.
- E-Ammoniak, E-Methanol und E-Diesel sind vielversprechend für die Schifffahrt, insbesondere für den Schwerlastseetransport, aufgrund ihrer geringen Emissionen und etablierten Anwendungen.
- E-Ammoniak ist besonders attraktiv als Wasserstoffträger und kann unter moderaten Bedingungen verflüssigt und gelagert werden.
- E-Methanol, E-Diesel und E-LNG sind interessante Optionen, besonders bei niedrigen CO2-Kosten.
Nachteile E-Fuels für Schiffe:
- Für E-Ammoniak und E-DME/OME sind neue Systeme für Transport und Lagerung sowie Änderungen an den Nutzungstechnologien erforderlich, da sie derzeit nicht als Kraftstoffe verwendet werden.
- Unsicherheiten hinsichtlich der Ausweitung der Nutzung, Kosten, Infrastrukturbedarf, betriebliche Anforderungen und gesundheitliche Auswirkungen.
Flugzeuge (E-Flugzeuge / Luftfahrt).
Effizienz: Für Langstreckenflüge gibt es keine direkte Elektro- oder Wasserstoffoption. E-Kerosin kann die Treibhausgasemissionen um etwa ein Drittel reduzieren, wenn es zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Es hat das Potenzial, bis zu 99 % CO2-Äquivalente zu reduzieren, wenn ausschliesslich erneuerbare Energie und Abwärme genutzt werden.
Vorteile E-Fuels für Flugzeuge:
- Sehr hohes und entscheidendes Potenzial zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, da es einer der Sektoren ist, der sich am schwersten direkt elektrifizieren lässt.
- E-Kerosin (SAF) ist der realisierbarste E-Kraftstoff für die Luftfahrt.
- Es bietet eine hohe Energiedichte und ist mit der bestehenden Infrastruktur und Flugzeugtriebwerken kompatibel.
- Kann mit bestehenden Kerosin-Treibstoffen gemischt werden (z.B. Jet A, Jet A-1).
- Die USA schätzen, dass E-Fuels bis 2050 den Grossteil oder die gesamte Nachfrage nach Flugbenzin decken könnten.
Nachteile E-Fuels für Flugzeuge:
- Die Produktionsmengen sind im Vergleich zum Bedarf noch vernachlässigbar.
- Hohe Produktionskosten.
- Selbst mit E-Fuels können die Emissionen nur teilweise reduziert werden.
- Kraftstoffe, die erheblich von Kerosin abweichen, sind aufgrund von zu hohem Verlust an Passagier- und Ladekapazität sowie hohen Investitionen in neue Flugzeug- und Triebwerkskonstruktionen inakzeptabel.
Motorräder (E-Motorräder).
E-Benzin als Potenzial für Zweiräder: Für Motorräder gelten im Grunde dieselben Effizienz- und Kostennachteile von E-Fuels im Vergleich zu direkter Elektrifizierung wie für Personenkraftwagen. Eine direkte, spezifische Analyse für E-Motorräder im Vergleich zu Verbrenner-Motorrädern mit E-Fuels ist in den Quellen nicht detailliert aufgeführt, aber die generellen Effizienzprinzipien des Leichtverkehrs würden hier analog Anwendung finden.
E-Fuels stellen in Sektoren wie der Luftfahrt und der Langstreckenschifffahrt eine vielversprechende und oft die einzig realisierbare Dekarbonisierungslösung dar, da eine direkte Elektrifizierung hier technisch nicht praktikabel oder ineffizient wäre. Im individuellen Strassenverkehr sind batterieelektrische Fahrzeuge aufgrund ihrer deutlich höheren Energieeffizienz und geringeren Emissionen die überlegene Wahl. E-Fuels könnten hier nur als Übergangs- oder Nischenlösung dienen.
Wie ist die Zukunft für E-Fuels als Ersatz für Diesel, Benzin und Kerosin unterteilt nach Anwendung.
E-Autos, E-Lastwagen, E-Schiffe, E-Flugzeuge und E-Motorräder, die direkt mit Strom betrieben werden, sind in jedem Fall deutlich effizienter als Verbrenner der gleichen Gattung, die mit E-Fuels betrieben werden.
Warum E-Fahrzeuge effizienter sind als Verbrenner mit E-Fuels.
Die höhere Effizienz von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen, die mit E-Fuels betrieben werden, liegt in den erheblichen Energieverlusten während der Herstellung und Nutzung von E-Fuels.
Produktionsverluste von E-Fuels:
E-Fuels sind keine primäre Energiequelle, sondern sekundäre Energieträger, deren Produktion und Nutzung mit mehreren Umwandlungsschritten verbunden sind.
Bei der Umwandlung von Elektrizität in Kohlenwasserstoff-Kraftstoff (einschliesslich CO2-Abscheidung) gehen bereits etwa 60 % der Energie verloren.
Der Prozess umfasst typischerweise die Elektrolyse von Wasser zur Gewinnung von Wasserstoff und dessen anschliessende Kombination mit Kohlenstoff (CO2 oder CO) zur Synthese der Kraftstoffe.
Verluste bei der Verbrennung:
Wenn der verbleibende Energiegehalt des E-Fuels in einem Verbrennungsmotor oder einer Gasturbine für mechanische Arbeit genutzt wird, gehen weitere etwa 70 % der Energie verloren.
Gesamtwirkungsgrad:
Der Gesamtwirkungsgrad von Strom zu Nutzenergie liegt bei E-Fuels, je nach Anwendung und Technologie, nur zwischen etwa 10 % und 35 %.
Direkte Elektrifizierung:
Elektrofahrzeuge hingegen haben wesentlich kürzere Umwandlungsketten, bei denen der Grossteil der elektrischen Energie erhalten bleibt. Dadurch benötigen E-Fahrzeuge zwei- bis vierzehnmal weniger Strom als die entsprechenden E-Fuel-Alternativen.
Die Nachhaltigkeit von E-Fuels hängt entscheidend davon ab, dass der benötigte Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt und das CO2 aus nachhaltigen Quellen gewonnen wird. Würden E-Fuels mit dem durchschnittlichen europäischen Strommix von 2021 hergestellt, würden sie höhere Treibhausgasemissionen verursachen als fossile Brennstoffe (dreimal so hoch wie fossile Brennstoffe).
Übersicht E-Autos.
E-Autos, Trends, Entwicklung, Technologien, Batterien, Märkte, Robotik, KI, FSD (autonomes Fahren), Ladezeit, Reichweite: Ausblicke in die dynamische Entwicklung des Elektroautomarktes: Technologien und globale Skalierung.
Übersichtsseiten mit Inhaltsverzeichnissen.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.