Netz der Zukunft - Dezentralisierung von Stromproduktion und Verbrauch im Schweizer Stromnetz.
22.5.2025
Die Energietransformation in der Schweiz, angetrieben durch die Energiestrategie 2050, die Dekarbonisierung und den Ausstieg aus der Kernenergie, hat weitreichende Auswirkungen auf das Stromnetz. Das bisherige System, das von zentraler Stromerzeugung in Grosskraftwerken und einer Energieflussrichtung vom Produzenten zum Endverbraucher geprägt war, wandelt sich grundlegend.
Inhaltsverzeichnis.
Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS).
Wie wirkt sich die Energietransformation auf das Schweizer Stromnetz aus?
Welches sind die Haupttreiber der Energietransformation?
Warum ist Dezentralisierung vorteilhaft?
Warum wird Netzausbau allein nicht reichen?
Welches sind die Herausforderungen der Dezentralisierung?
Welche Netzebene bildet den Engpass?
Ist die Digitalisierung der Netzkomponenten bereit für die Dezentralisierung?
Wer profitiert von dezentraler Energieversorgung?
Warum wird mehr Strom benötigt?
Müssen noch mehr Gaskraftwerke gebaut werden?
Reichen die Pumpspeicher-Kraftwerke in der Schweiz?
Warum ist der Ausbau der Photovoltaik nötig?
Die Bedeutung von ZEV - Zusammenschluss zum Eigenverbrauch.
Welche Massnahmen muss die Schweiz unbedingt umsetzen?
Was erschwert den Netzausbau in der Schweiz?
Wie hoch sind die geplanten Investitionen von Swissgrid bis 2040?
23.12.2025, ein Blick nach Deutschland:
Batterien statt AKWs.
Trotz der vorhandenen Technik und des enormen Einsparpotenzials kann Deutschland diese Vorteile nicht voll ausschöpfen. Die deutsche Planung erfolgt oft "Top-down" (von oben nach unten), während Experten einen "Bottom-up"-Ansatz (von unten nach oben) fordern: Jede Energiemenge, die lokal erzeugt, verbraucht und gespeichert werden kann, muss nicht transportiert werden, wodurch Kosten und CO2 gespart werden.
Weitere Informationen dazu:
Energiemix, Erneuerbare, Stromspeicher, Netzausbau und Digitalisierung, Smart Meter. Wirtschaftlichkeit, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven der Energiewende in Deutschland.
03.12.2025, Batteriespeichersysteme.
Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS).
In diesem Artikel geht es um die künftige Rolle von Batteriespeichersystemen (BESS), gestützt auf den aktuellen exponentiellen Boom, die wirtschaftlichen Treiber und die notwendigen infrastrukturellen sowie regulatorischen Anpassungen.
Mehr dazu:
Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS), Kapazitäten, Netzstabilität, Batterietechnologien, Anwendungen, Strompreisarbitrage. Batteriespeicher - ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende und die Versorgungssicherheit.
Grünstrom-Batteriespeichersysteme (BESS).
6.11.2025, Update
Wie wirkt sich die Energietransformation auf das Schweizer Stromnetz aus?
Die zunehmende Dezentralisierung der Stromproduktion durch erneuerbare Energien wie Photovoltaik (PV) und Windkraft ist ein Haupttreiber dieses Wandels. Immer mehr Strom wird dezentral in kleineren Anlagen erzeugt, oft am Ende der Verteilnetze. Dies führt dazu, dass das Stromnetz Strom in beide Richtungen transportieren können muss (bidirektionale Stromflüsse), was die Netzbewirtschaftung fundamental verändert. Gleichzeitig erhöht sich der Stromverbrauch aufgrund der Elektrifizierung von Verkehr und Wärmeversorgung zum Beispiel durch Elektroautos und Wärmepumpen, was den Strombedarf insgesamt deutlich ansteigen lässt. Dies führt zu neuen Lastmustern und potenziellen Lastspitzen, insbesondere durch das Laden von Elektrofahrzeugen oder den Betrieb von Klimaanlagen.
Diese Entwicklungen stellen das bestehende Netz vor grosse Herausforderungen. Das Stromnetz muss leistungsfähiger werden, um die höheren Strommengen und die geänderten Flussrichtungen bewältigen zu können. Bestehende Leitungen und Transformatoren sind teilweise nicht für die aktuelle und zukünftige Belastung ausgelegt, und in einigen Quartieren stösst das Netz bereits an seine Grenzen.
Eine zentrale Herausforderung ist die Integration der zunehmend volatilen und unregelmässig anfallenden erneuerbaren Energien (z.B. durch Wetterereignisse) ins Netz. Die starke Volatilität zu beherrschen, ist technisch sehr anspruchsvoll. Angebot und Nachfrage müssen jederzeit ausgeglichen sein, um Netzabfälle oder Stromunterbrechungen zu vermeiden.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind massive Anstrengungen und Investitionen notwendig. Das Netz muss ausgebaut, verstärkt, modernisiert und gesamthaft erneuert werden. Swissgrid hat im Rahmen ihres Projekts "Strategisches Netz 2040" 31 wesentliche Projekte im Schweizer Höchstspannungsnetz identifiziert, die bis 2040 umgesetzt werden müssen und rund 5,5 Milliarden Franken kosten werden. Diese Kosten müssen letztlich von den Verbrauchern getragen werden.
Swissgrid: Netz der Zukunft – Weiterentwicklung des Schweizer Höchstspannungsnetzes.
Ein
Schlüsselelement für das Netz der Zukunft ist die Digitalisierung. Intelligente
Netze, also Smart Grids, die IT-Technologien mit dem Stromnetz verbinden,
können dieses sicherer, flexibler, effizienter und wirtschaftlicher machen.
Smart Metering (intelligente Messgeräte) liefert wichtige Daten für Verbraucher
und Netzbetreiber und gilt als Grundlage für ein dynamisches Stromnetz. Mittels
dynamischem Lastmanagement soll das Netz intelligenter gesteuert und Lasten
besser ausgeglichen werden, was elementar wichtig ist, um mit Belastungsspitzen
erneuerbarer Energie mithalten zu können.
Netz der Zukunft - Digitalisierung der Schweizer
Stromnetze – bidirektionale, intelligente Smart Grids.
Digitalisierung der Schweizer Stromnetze.
Weitere wichtige Lösungen sind die Erhöhung der Speicherkapazitäten auf verschiedenen Ebenen. Batteriespeicher können überschüssige Energie lokal zwischenspeichern und so den Eigenverbrauch erhöhen sowie das Netz entlasten. Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) ermöglichen es, lokal erzeugten Strom direkt innerhalb einer Gemeinschaft zu verbrauchen, was ebenfalls zur Netzentlastung beitragen kann. Auch das bidirektionale Laden von Elektrofahrzeugen (V2G) wird als Möglichkeit gesehen, E-Fahrzeuge als temporäre Energiespeicher zu nutzen und damit die Netzstabilität zu unterstützen.
Speicherkapazitäten auf verschiedenen
Ebenen.
Batteriespeicher - alle Artikel.
Energiespeicher - alle Artikel.
Zudem
müssen Anreize geschaffen werden, die dazu motivieren, Strom netzdienlich zu
verbrauchen, also dann, wenn er im Übermass verfügbar ist. Dies kann durch
dynamische Tarife geschehen. Auch die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren
für den Um- und Ausbau der Stromnetze ist zwingend notwendig, da diese derzeit
sehr lange dauern können. Die Vorlage "Netzexpress" zielt darauf ab,
diese Verfahren rascher umzusetzen.
Schliesslich ist die engere Anbindung an das europäische Verbundnetz wichtig, um das Schweizer Energiesystem robuster zu machen. Ein Stromabkommen mit der EU ist eine wichtige Bedingung.
Welches sind die Haupttreiber der Energietransformation?
Die Transformation des Schweizer Energiesystems und damit auch des Stromnetzes wird hauptsächlich von drei zentralen Treibern vorangetrieben.
Dekarbonisierung.
Dies ist das Ziel der Energiestrategie 2050 des Bundesrates. Bis 2050 soll die Energieversorgung der Schweiz netto keine Treibhausgase mehr freisetzen. Dies führt zu einer zunehmenden Elektrifizierung der Energieversorgung, da fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Insbesondere der Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen und der Umstieg auf Elektromobilität sowie der Bau von Rechenzentren erhöhen den Strombedarf deutlich. Strom wird dadurch zur bedeutendsten Energieform im 21. Jahrhundert, und viele Forscher prognostizieren eine Verdoppelung des Strombedarfs bis 2050.
Dezentralisierung.
Das bisherige zentralisierte Modell, bei dem Strom in grossen Kraftwerken erzeugt und weit transportiert wurde, ändert sich. Immer mehr Strom wird dezentral in kleineren Produktionsanlagen erzeugt, hauptsächlich mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik (PV) und Windkraft. Dies ist bedingt durch die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien, die oft eine geringere räumliche Konzentration und Energiedichte aufweisen. Auch der langfristige Ausstieg aus der Kernenergie in der Schweiz ist ein Treiber für die Zunahme dezentraler Produktion. Die Dezentralisierung wird zudem durch soziale und wirtschaftliche Faktoren wie lokale Wertschöpfung, breitere Teilhabe (z.B. Bürgerbeteiligung) und den Wunsch nach weitgehender Eigenversorgung sowie grössere Akzeptanz gefördert. Technologische Entwicklungen sind ebenfalls ein treibender Faktor für die Dezentralisierung.
Digitalisierung.
Die Digitalisierung erhöht die Automatisierung, Flexibilität und Effizienz im Energiesystem. Sie ermöglicht die Entwicklung intelligenter Netze (Smart Grids), die IT-Technologien mit dem Stromnetz verbinden. Smart Metering (intelligente Messgeräte) liefert wichtige Informationen für Verbraucher und Netzbetreiber und ermöglicht eine automatisierte Kontrolle des Verhaltens einzelner Prosumer.

Die Digitalisierung ist entscheidend, um die zunehmend komplexere Netzbewirtschaftung mit bidirektionalen Flüssen und volatiler Einspeisung zu handhaben.
Netz der Zukunft - Digitalisierung der Schweizer Stromnetze – bidirektionale, intelligente Smart Grids.
Digitalisierung - Schweizer Smart Grid.
Diese Haupttreiber führen zu einem tiefgreifenden
Wandel in der Art und Weise, wie Strom erzeugt, verteilt und verbraucht wird.
Sie stellen die bestehende Netzinfrastruktur vor grosse Herausforderungen und
erfordern massive Investitionen in Ausbau, Verstärkung, Modernisierung und
Digitalisierung des Netzes.
Warum ist Dezentralisierung vorteilhaft?
Die Dezentralisierung ein zentraler Pfeiler der Energiewende und bietet eine Reihe von Vorteilen für das Stromnetz und die Energieversorgung insgesamt.
Förderung erneuerbarer Energien.
Dezentrale Energieerzeugung, insbesondere durch Solaranlagen und kleine Windparks, ermöglicht es Verbrauchern und Gemeinschaften, selbst erneuerbare Energie zu produzieren und ins Netz einzuspeisen. Dies stärkt den Anteil grüner Energie im Mix.
Erhöhung der Energieunabhängigkeit und Autarkie.
Dezentralisierung ermöglicht eine höhere Unabhängigkeit von grossen zentralisierten Energieversorgern und Kraftwerken. Verbraucher und Regionen können selbst Energie produzieren und nutzen, was lokale Energieautarkie fördert.
Potenzielle Reduzierung der Netzausbaukosten.
Dezentrale Erzeugung und lokaler Verbrauch können den Bedarf an teurem Ausbau langer Stromleitungen und grosser Übertragungsnetze verringern. Lokale Energieerzeugung und -verbrauch entlasten das Netz und senken langfristig die Stromkosten für alle Verbraucher. Investitionen in die dezentrale Handhabung von Leistungsspitzen wird als zielführender angesehen als der reine Verteilnetzausbau für diese Zwecke.
Verbesserung der Netzstabilität und -resilienz.
Durch die Verteilung der Energieproduktion auf viele kleinere Anlagen wird das Stromnetz stabiler und widerstandsfähiger gegenüber Störungen. Wenn ein einzelner dezentraler Produzent ausfällt, fällt dies oft nicht ins Gewicht, da andere Akteure Schwankungen ausgleichen können.
Effizientere Nutzung der Energie durch verbrauchsnahe Produktion.
Strom wird nah am Verbraucher erzeugt, was die Transportwege verkürzt und Übertragungsverluste minimiert. Dezentrale Systeme ermöglichen eine effizientere Nutzung der Primärenergie.
Förderung lokaler Wertschöpfung und Arbeitsplätze.
Dezentrale Netze fördern die lokale und regionale Wertschöpfung und können neue Arbeitsplätze in der Energiebranche schaffen.
Ermöglichung der "Demokratisierung" der Energieversorgung.
Bürgerinnen und Bürger können selbst zu Energieproduzenten werden, was eine breitere Teilhabe und Bürgerbeteiligung ermöglicht.
Bessere Steuerung und Flexibilität durch Digitalisierung.
In Verbindung mit Digitalisierung und intelligenten Systemen (Smart Grids) ermöglicht Dezentralisierung eine bessere Steuerung und den Ausgleich von Lasten. Dies ist elementar wichtig, um mit den Belastungsspitzen der erneuerbaren Energie mithalten zu können. Technologien wie virtuelle Kraftwerke bündeln dezentrale Erzeuger und Speicher zur Laststeuerung und Erhöhung der Versorgungssicherheit. Bidirektionales Laden von E-Autos und lokale Speicher können zur Netzstabilität beitragen.
Anpassung an regionale Gegebenheiten.
Die Kombination verschiedener dezentraler Technologien erlaubt es, auf regionale Besonderheiten Rücksicht zu nehmen (z.B. Wasserkraft bei viel Wasser, Windkraft bei viel Wind), was zu hoher Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit beitragen kann.
Lösung des Energietrilemmas.
Dezentralisierung, insbesondere mit erneuerbaren Energien, kann dazu beitragen, das Abwägen zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten sowie der Gewährleistung der Versorgungssicherheit zu verbessern.
Während Dezentralisierung erhebliche Vorteile bietet, stellt sie das bestehende Netz auch vor Herausforderungen, da es leistungsfähiger und kommunikativer werden muss, um bidirektionale Flüsse zu bewältigen. Die Integration volatiler Quellen und die notwendigen Netzumbaumassnahmen erfordern erhebliche Investitionen und neue Managementansätze. Dennoch wird Dezentralisierung als Schlüssel für eine nachhaltige und zuverlässige Energieversorgung der Zukunft angesehen.
Warum wird Netzausbau allein nicht reichen?
Der reine Netzausbau allein ist kein ausreichender Ansatz, um die Herausforderungen der Energiewende für das Schweizer Stromnetz zu bewältigen. Es braucht eine Kombination verschiedener Massnahmen.
Volatilität der erneuerbaren Energien.
Erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik (PV) und Windkraft produzieren Strom nicht kontinuierlich, sondern abhängig von Wetter und Tageszeit. Das Netz muss mit diesen zunehmenden Schwankungen und Belastungs-Peaks umgehen können. Ein Ausbau, der nur auf die maximale Produktionsleistung dieser Anlagen ausgelegt wäre, ist ineffizient und viel zu teuer.
Dezentralisierung und bidirektionale Flüsse.
Mit der Zunahme dezentraler PV-Anlagen auf Dächern und Fassaden, insbesondere auf der Niederspannungsebene (Netzebene 7), ändert sich die Flussrichtung im Netz. Strom fliesst nicht mehr nur vom zentralen Grosskraftwerk zum Verbraucher, sondern auch dezentral vom Produzenten (Prosumer) ins Netz. Das bestehende Netz wurde auf den Strombezug dimensioniert, nun muss es auch die Einspeisung bewältigen, die oft höher ist als der bisherige Bezug. Ein reiner physikalischer Ausbau kann dies bis zu einem gewissen Grad leisten, stösst aber in einigen Quartieren bereits an seine Grenzen.
Sommerliche Überschüsse und begrenzte Aufnahme.
Der starke Ausbau der PV-Anlagen führt dazu, dass es im Sommerhalbjahr voraussichtlich grosse Stromüberschüsse geben wird, die nicht vollständig verbraucht werden können. Selbst wenn das Verteilnetz ausgebaut würde, um diese Leistungsspitzen aufzunehmen, könnten sie mangels Abnehmern voraussichtlich nicht oder nur zu Zeiten tiefer oder negativer Marktpreise ins Netz eingespeist oder exportiert werden. Der physikalische Netzausbau allein löst nicht das Problem, dass der Strom zum Zeitpunkt der Produktion nicht immer benötigt wird.
Kostenineffizienz bei Fokus auf Peaks.
Es ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, das Netz auf die maximale Leistung von PV-Anlagen zu dimensionieren. Dies würde den Netzausbau noch teurer machen und die Kosten müssten von allen Stromkunden getragen werden. Das Netz kann nicht so gebaut werden, dass es sämtliche Produktions-Peaks absorbieren kann, da dies ineffizient und viel zu teuer wäre.
Komplexität und mangelnde Transparenz.
Das Verteilnetz ist heute noch nicht flächendeckend automatisiert und Lastflüsse sind nicht in Echtzeit einsehbar. Mit der zunehmenden Dezentralisierung wird die Netzbewirtschaftung komplexer. Ein reiner Ausbau adressiert nicht die Notwendigkeit einer besseren Steuerung und Transparenz.
Daher sind ergänzend zum notwendigen physikalischen Um- und Ausbau des Netzes weitere Massnahmen erforderlich:
Digitalisierung und Smart Grids.
Die Vernetzung des Stromnetzes mit IT-Technologien (Smart Grids) ist entscheidend, um das Netz sicherer, flexibler, effizienter und wirtschaftlicher zu machen. Smart Metering liefert notwendige Daten für Netzbetreiber und ermöglicht intelligente Steuerungen.
Intelligente Steuerung und Lastmanagement.
Mittels dynamischem Lastmanagement soll das Netz intelligenter gesteuert und Lasten besser ausgeglichen werden. Es braucht Anreize, um den Strom dann zu verbrauchen, wenn er im Übermass verfügbar ist ("netzdienliches Verhalten").
Speicherkapazitäten.
Massiv mehr Speicherkapazitäten sind zentral, um sommerliche Überschüsse sinnvoll zu nutzen. Batteriespeicher auf Haushaltsebene oder in Quartieren können überschüssige Energie lokal zwischenspeichern, den Eigenverbrauch erhöhen und das Netz entlasten. Auch das bidirektionale Laden von E-Autos (V2G) und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) bieten Potenzial für die Netzstabilität und Entlastung durch lokalen Verbrauch.
Dezentrales Management von Leistungsspitzen.
Anstatt das Netz primär für seltene Produktionsspitzen auszubauen, wird es als zielführender erachtet, in den dezentralen Umgang mit diesen Spitzen zu investieren. Dies kann durch Speicher, Lastmanagement und die dynamische Begrenzung der Einspeiseleistung von PV-Anlagen erfolgen.
Flexibilitätserschliessung.
Energieversorgungsunternehmen (EVU) müssen Zugang zu relevanten Flexibilitäten wie E-Fahrzeugen, PV-Anlagen und Wärmepumpen erhalten, um den stabilen Verteilnetzbetrieb bei angemessenen Kosten zu gewährleisten und neue Geschäftsmodelle zu erschliessen.
Welches sind die Herausforderungen der Dezentralisierung?
Der Zubau erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Windkraft sowie die Elektrifizierung von Wärme und Mobilität sind erhebliche Herausforderungen für die Stromnetze, insbesondere für die Verteilnetze auf den unteren Ebenen. Die wichtigsten Herausforderungen der Dezentralisierung für die Netzbetreiber sind:
Anpassung an volatile und dezentrale Einspeisung.
Strom wird zunehmend dezentral in vielen kleineren Anlagen erzeugt. Diese Quellen, wie Photovoltaik und Wind, produzieren nicht kontinuierlich, sondern abhängig von Wetter und Tageszeit, was zu zunehmenden Schwankungen und Belastungs-Peaks im Netz führt. Das bestehende Netz wurde für eine zentrale, vorhersehbare Erzeugung und unidirektionale Flüsse (vom Kraftwerk zum Verbraucher) ausgelegt. Es muss nun mit diesen volatilen und bidirektionalen Flüssen zurechtkommen.
Belastung der unteren Netzebenen.
Der Engpass liegt vermehrt auf der Niederspannungsebene (Netzebene 7), wo viele neue Solaranlagen angeschlossen werden und im Sommer grosse Strommengen einspeisen. Diese Ebene ist heute oft noch praktisch nicht automatisiert und Lastflüsse sind nicht in Echtzeit einsehbar.
Bewältigung neuer Lastmuster.
Auch der Stromverbrauch verändert sich durch die Dezentralisierung, insbesondere durch die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen. Dies führt zu unvorhersehbaren Lastspitzen, z.B. am Abend beim Aufladen von Elektroautos.
Zunehmende Komplexität des Netzbetriebs.
Die Netzbewirtschaftung wird komplexer. Es ist eine hochdynamische Regelfähigkeit und der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie erforderlich. Es braucht ein besseres Verständnis des aktuellen Netzzustands.
Finanzielle Herausforderungen.
Die Transformation bringt erhebliche finanzielle Herausforderungen mit sich. Die zunehmende private Strom-Selbstversorgung (Prosumer) führt dazu, dass Verbraucher das Verteilnetz weniger stark nutzen und somit weniger zur Finanzierung von Erstellungs- und Unterhaltskosten beitragen. Gleichzeitig nutzen sie das Netz weiterhin als Backup-Lösung. Dies kann zu einer sogenannten «Entsolidarisierung des Stromnetzes» führen, bei der die Notwendigkeit besteht, die Netznutzungsgebühren zu erhöhen, was eine Quer-Subventionierung von Prosumern durch andere Verbraucher verursachen kann. Netzbetreiber stehen vor dem Interessenkonflikt, die Refinanzierung ihres Netzes sicherzustellen, während lokale Geschäftsmodelle begünstigt werden. Der notwendige Um- und Ausbau des Netzes erfordert massive Investitionen.
Notwendigkeit von digitaler Infrastruktur und intelligenten Systemen.
Ein aktives Management des Netzes ist nur möglich, wenn Infrastruktur und Flexibilitäten vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) erschlossen werden. Es braucht die adäquate Messung und Regelung des Verteilnetzes. Intelligente Steuerungs- und Regelungssysteme wie virtuelle Kraftwerke und Energiemanagementsysteme (EMS) sind notwendig, um dezentrale Erzeuger und Speicher effizient zu nutzen und Schwankungen auszugleichen. Die Digitalisierung ist entscheidend, aber die Umsetzung steht noch am Anfang.
Integration von Speichern und Flexibilitäten.
Um mit den Schwankungen zurechtzukommen, sind Energiespeicher und die Nutzung von Anlagen mit planbaren Produktionsvolumina wichtig. Die Integration und Steuerung dieser Flexibilitäten (z.B. Speicher, E-Autos, Wärmepumpen) ist eine Herausforderung. EVUs müssen Zugang zu diesen Flexibilitäten erhalten, was aktuell noch nicht etabliert ist und Diskussionen über den besten Ansatz gibt.
Sommerliche Überschüsse und ineffiziente Netznutzung.
Der Zubau von PV führt im Sommer zu voraussichtlich grossen Stromüberschüssen, die nicht vollständig verbraucht oder vom Netz aufgenommen werden können. Es ist unwirtschaftlich, das Netz so auszubauen, dass es sämtliche Produktions-Peaks absorbieren kann.
Regulatorische und politische Hürden.
Die Energiewende und Dezentralisierung erfordern eine Anpassung der Marktbedingungen und Regulierung. Langwierige Plangenehmigungsverfahren für den Netzausbau und die Sanierung stellen eine grosse Herausforderung dar und verzögern Projekte um Jahre. Es braucht stabile Rahmenbedingungen, z.B. für die Abregelung von PV-Anlagen oder die Förderung netzdienlichen Verhaltens. Auch Fragen der Verantwortlichkeit und Haftung bei Schäden durch dezentrale Systeme sind zu klären.
Anpassung von Netzbetriebskonzepten.
Bisherige Konzepte für die Netzstabilität, wie die Regelenergie, basieren auf zentralen Kraftwerken. Der Übergang zu einem dezentraleren System erfordert die Entwicklung neuer Konzepte für den Netzbetrieb und die Koordination im europäischen Verbundnetz.
Welche Netzebene bildet den Engpass?
Die Netzebene 7, das Niederspannungsnetz, bildet den hauptsächlichen Engpass im Zuge der zunehmenden Dezentralisierung der Energieversorgung. Die Niederspannungsebene (Netzebene 7) ist die lokale Verteilnetzebene (unter 1 kV), die den Strom an Haushalte und Unternehmen verteilt. Genau auf dieser Ebene werden derzeit sehr viele neue Photovoltaikanlagen angeschlossen.
Das Netz auf dieser Ebene stösst bereits in einzelnen Quartieren an seine Grenzen. Früher war die Dimensionierung des Netzes primär auf den Strombezug (Verbrauch) ausgelegt, heute ist es zunehmend die Stromeinspeisung (Produktion). Die eingebauten Reservekapazitäten sind aufgebraucht. Im Gegensatz zum Übertragungsnetz, das bereits hochaufgelöst und in Echtzeit gemessen, überwacht und gesteuert wird, ist das elektrische Verteilnetz auf der Netzebene 7 praktisch nicht automatisiert. Lastflüsse sind nicht in Echtzeit einsehbar. Es gab bisher keine Anreize, das Verteilnetz in hoher Granularität zu messen und zu steuern.
Die dezentrale, volatile Einspeisung von Photovoltaik und Windkraft sowie neue Lastmuster durch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen führen zu zunehmenden Schwankungen und Belastungs-Peaks [siehe Konversation], was das historisch für unidirektionale Flüsse ausgelegte Netz vor Herausforderungen stellt. Die Sicherstellung der Spannungshaltung und Spannungsqualität wird durch den Anstieg der dezentralen Einspeisung, Elektromobilität und Wärmepumpen erschwert.
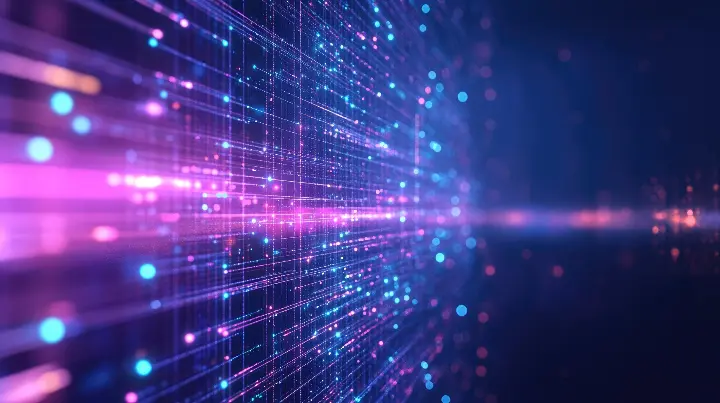
Während auch andere Netzebenen, einschliesslich des Übertragungsnetzes (Netzebene 1), Anpassungen und Investitionen erfordern, insbesondere durch langwierige Bewilligungsverfahren, wird der "Flaschenhals" im Zusammenhang mit der unmittelbaren Integration der vielen kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen explizit auf der Netzebene 7 verortet. Die Notwendigkeit des physikalischen Netzausbaus ist hier ungemein wichtig, muss aber durch Digitalisierung und intelligente Steuerung ergänzt werden.
Ist die Digitalisierung der Netzkomponenten bereit für die Dezentralisierung?
Die Digitalisierung der Netzkomponenten ein essentieller und vorangetriebener Prozess für die Dezentralisierung der Energieversorgung, aber sie ist noch nicht flächendeckend oder vollständig "bereit" für die Bewältigung aller damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere auf der Niederspannungsebene.
Digitalisierung ist unerlässlich und wird vorangetrieben. Ein intelligenter, kosteneffizienter und stabiler Betrieb des zukünftigen Verteilnetzes erfordert die Digitalisierung und ein aktives Management. Das Stromnetz der Zukunft muss digital, leistungsfähiger und auch kommunikativ werden. Die Digitalisierung ermöglicht es, Erzeugung, Verbrauch und Speicherung optimal zu vernetzen, abzustimmen und Stromflüsse zu steuern, was den notwendigen Netzausbau reduzieren kann.
Smart Grids (intelligente Netze) und Energiemanagement-Systeme (EMS) werden als Technologien genannt, die eine effiziente Integration dezentraler Quellen und die Steuerung des Stromflusses ermöglichen. Die Digitalisierung unterstützt die Automatisierung des Eigenverbrauchs, indem z.B. der Strombezug von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen auf hohe Photovoltaik-Einspeisung abgestimmt wird.
EVUs treiben die Digitalisierung des Netzes voran, nutzen Daten von Smart Metern und entwickeln dynamisches Lastmanagement zur intelligenteren Steuerung und Lastverteilung. Der Roll-out von Smart Metern ist im Gange und gilt als Grundlage für ein dynamisches Stromnetz. Smart Metering ermöglicht Echtzeit-Monitoring und kann helfen, netzunkonformes Verhalten zu erkennen.
Technische Systeme sind vorhanden, aber die Integration hinkt hinterher: Zwar sind technische Systeme weitgehend verfügbar, aber ein ineinandergreifendes, intelligentes System, basierend auf hochaufgelösten Daten und verbunden mit intelligenten, selbstoptimierenden Regelalgorithmen ist grösstenteils Zukunftsmusik. Die Interoperabilität und Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen und Akteuren stellen eine Schlüsselrolle dar, aber die Standards und Anreizsysteme sind noch unklar.
Der Engpass liegt primär im Verteilnetz (Niederspannungsebene) und dessen Digitalisierungsgrad. Während das Übertragungsnetz (Netzebene 1) bereits hochaufgelöst und in Echtzeit gemessen, überwacht und gesteuert wird, ist das elektrische Verteilnetz auf der Netzebene 7 (Niederspannung) praktisch nicht automatisiert. Lastflüsse im Verteilnetz sind nicht in Echtzeit einsehbar. Es gab bisher keine Anreize, das Verteilnetz in hoher Granularität zu messen und zu steuern. Die Notwendigkeit der Echtzeittransparenz im Verteilnetz wächst jedoch stark durch die Zunahme dezentraler Anlagen, E-Mobilität und Wärmepumpen.

Swissgrid Control: Netzleitstelle in Aarau.
@ Copyright Swissgrid
Digitalisierung allein ist nicht die vollständige Lösung. Die grossen Anforderungen an das Stromnetz zukünftig sind nicht allein mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zu meistern. Es braucht beide Strategien: Digitalisierung und physikalischen Netzausbau. Ein ausschliesslicher Fokus auf Netzausbau ist jedoch auch nicht zielführend; die richtige Incentivierung der Konsumenten sowie adäquate Messung und Regelung sind nötig.
Die Wichtigkeit der Digitalisierung für die Dezentralisierung ist erkannt und die Energieversorger investieren in diesem Bereich, insbesondere in Smart Meter und intelligente Steuerungssysteme. Die grundlegenden Technologien sind weitgehend vorhanden. Allerdings ist das Verteilnetz, wo die meisten dezentralen Anlagen angeschlossen werden, historisch bedingt kaum automatisiert und es fehlt an Echtzeit-Transparenz und integrierten, intelligenten Systemen, die über einfache Steuerbefehle hinausgehen. Die vollständige digitale Vernetzung und Optimierung aller dezentralen Komponenten ist noch Zukunftsmusik. Daher ist die Digitalisierung derzeit ein kritischer Engpass, der parallel zum physikalischen Ausbau und der Anpassung regulatorischer Rahmenbedingungen dringend weiter vorangetrieben werden muss, um die Herausforderungen der Dezentralisierung zu bewältigen.
Wer profitiert von dezentraler Energieversorgung?
Die Dezentralisierung der Energieversorgung, die durch den Ausbau erneuerbarer Energien wie Photovoltaik und Windkraft vorangetrieben wird, bringt verschiedene Akteure mit sich und kann für unterschiedliche Beteiligte Vorteile bringen. Endkunden und Verbraucher können durch eigene Anlagen (z.B. PV) und Batteriespeicher einen höheren Eigenverbrauch erzielen und so ihre Energieunabhängigkeit erhöhen.
Intelligente Steuerungssysteme (wie HEMS) und dynamische Tarife ermöglichen es ihnen, ihren Verbrauch an die Erzeugung anzupassen, was zu sehr günstigen Strompreisen führen kann. Sie können Teil von lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) oder virtuellen Kraftwerken werden, um Strom lokal zu beziehen oder Überschüsse zu vermarkten. Die Investition in eigene Anlagen kann sich nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich lohnen. Überschüssige Energie kann ins Netz eingespeist und vergütet werden.
Batteriespeicher und Solaranlagen, die im Inselbetrieb laufen können, erhöhen die persönliche Versorgungssicherheit. Sie erhalten die Chance, selbst Energieproduzenten zu werden und tragen zur Demokratisierung der Energieversorgung bei. Modelle wie Energiecontracting im Gebäudebereich entlasten Immobilienbesitzer und Bauunternehmer von Betrieb und Risiko und bieten langfristig gesetzeskonforme erneuerbare Energie zu wettbewerbsfähigen Gesamtkosten.
Dezentrale, verbrauchernahe Erzeugung kann die Netzbelastung für Verteilnetzbetreiber (VNB) und Energieversorgungsunternehmen (EVU) reduzieren. Sie können durch Digitalisierung und intelligente Systeme (Smart Grids, dynamisches Lastmanagement) das Netz intelligenter steuern, Lasten ausgleichen und so die Effizienz steigern.
Die Erschliessung und intelligente Nutzung von Flexibilitäten bei Endkunden (E-Autos, Wärmepumpen, Speicher) hilft ihnen, die Netzstabilität sicherzustellen, die Ausgleichsenergie zu optimieren und potenziell Kosten zu reduzieren. Der Zugang zu Flexibilitäten ermöglicht die Erschliessung neuer Geschäftsmodelle mit Endkunden. Ein intelligentes dezentrales Management kann die Notwendigkeit teuren Netzausbaus reduzieren, der allein für seltene Produktionsspitzen unwirtschaftlich wäre.
Durch die Schaffung von Voraussetzungen für lokales Regeln (Edge Intelligence) können EVUs einen nachhaltigen Vorteil erlangen. Sie können von neuen Konzepten für den Netzbetrieb profitieren, die sich aus der dezentralen Einspeisung ergeben.
Dezentrale Energieversorgung fördert die lokale und regionale Wertschöpfung und schafft neue Arbeitsplätze. Weniger Transportwege führen zu geringeren Transportverlusten und -kosten. Kommunen können selbst Akteure im Energiesystem werden. Die Anpassung an regionale Gegebenheiten durch passende Technologien (Wasser, Wind) sorgt für hohe Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Die Dezentralisierung ist ein Schlüssel für eine nachhaltige Energieversorgung für die gesamte Energiewirtschaft und Gesellschaft. Sie ermöglicht eine effektivere Nutzung erneuerbarer Energien. Sie reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und importierter Primärenergie. Das Stromnetz wird flexibler, widerstandsfähiger und stabiler gegenüber Störungen. Sie trägt zur Senkung von CO2-Emissionen bei. Die Kombination verschiedener Technologien ermöglicht eine bedarfsgerechte und effizientere Energieerzeugung.
Warum wird mehr Strom benötigt?
Da sich das Schweizer Energiesystem in einem grossen Umbruch befindet, der hauptsächlich durch die Dekarbonisierung vorangetrieben wird mehr Strom benötigt. Die Hauptgründe für den steigenden Strombedarf sind vielfältig.
Elektrifizierung des Heizungs- und Wärmesektors.
Fossile Energieträger wie Öl und Gas zum Heizen sollen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Dies geschieht vor allem durch den Einsatz von elektrischen Wärmepumpen, die die Umweltenergie nutzen und fossile Heizkessel ersetzen. Die Anzahl der Wärmepumpeninstallationen in der Schweiz ist stark gestiegen. Obwohl Wärmepumpen effizienter sind, resultiert daraus ein Anstieg des Strombedarfs.
Elektrifizierung der Mobilität.
Benziner und Verbrennungsmotoren werden zunehmend durch Elektroautos ersetzt. Die Zahl der Elektroautos in der Schweiz wächst stetig. Das Wachstum der Elektromobilität führt zu einem erheblich steigenden Strombedarf.
Digitalisierung und Rechenzentren.
Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft und der Bau grosser Rechenzentren erhöhen den Strombedarf ebenfalls deutlich.
Ersatz von Kernkraftwerken.
Die Schweiz steigt langfristig aus der Kernenergie aus. Die Atomkraftwerke sollen unter anderem durch den massiven Zubau erneuerbarer Energien ersetzt werden, was bedeutet, dass mehr Strom aus neuen Quellen produziert werden muss, um die bisherige Kernkraftproduktion zu kompensieren.
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum.
Generell trägt auch das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft zum Anstieg des Stromverbrauchs bei.
Zunehmende Nutzung von Klimaanlagen.
Insbesondere in heissen Sommern steigt das Bedürfnis nach Klimaanlagen. Der Energieverbrauch für die Kühlung nähert sich demjenigen für die Heizung an und erhöht den Druck auf die Kraftwerke und belastet die Stromnetze zusätzlich. Dies kann auch dazu führen, dass die Spitzenlast im Stromnetz bald im Sommer auftritt.
Insgesamt wird der Landesstromverbrauch bis 2050 laut einer VSE-Studie voraussichtlich um rund 50% auf ca. 90 TWh ansteigen, verglichen mit heute etwa 60 TWh. Um das Netto-Null-Ziel für Treibhausgasemissionen zu erreichen, ist die umfassende Elektrifizierung im Verkehrs- und Wärmesektor notwendig. Dies treibt den Wandel voran und erfordert einen entsprechenden Ausbau der inländischen Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen.
Müssen noch mehr Gaskraftwerke gebaut werden?
Gemäss der VSE-Studie "Energiezukunft 2050", kann man sagen, dass der Bau weiterer Gaskraftwerke als eine Option zur Schliessung der Winterstromlücke betrachtet wird, insbesondere wenn die Ausbauziele für erneuerbare Energien gemäss dem Stromgesetz nicht vollständig erreicht werden oder andere winterrelevante Produktionsquellen und Importmöglichkeiten begrenzt sind.
Die Winterstromversorgung wird als die grösste Herausforderung für die zukünftige Energieversorgung angesehen. Dies liegt am steigenden Strombedarf durch die Elektrifizierung (Elektroautos, Wärmepumpen) und der Abschaltung der Kernkraftwerke (ab den 2040er Jahren). Das Stromgesetz legt ehrgeizige Ausbauziele für erneuerbare Energien fest, die eine bessere Ausgangslage für die Winterversorgung schaffen sollen. Der Fokus liegt dabei stark auf der Photovoltaik, aber auch die Windkraft wird als wichtig erachtet, gerade weil sie im Winter Erträge liefern kann.
Die VSE-Studie zeigt jedoch, dass selbst bei Erreichung der Ausbauziele im Stromgesetz in den Wintermonaten ergänzende Stromproduktion benötigt wird. Gaskraftwerke werden als flexibel einsetzbar und gut geeignet für diese ergänzende Produktion genannt. Um die Klimaziele zu erreichen, sollten sie möglichst klimaneutral betrieben werden, z.B. mit CO2-Abscheidung oder erneuerbaren Gasen.
Der Bedarf an Gaskraftwerken hängt stark von der Entwicklung anderer Produktionsquellen ab: Geht man von einem weniger starken Ausbau der Windkraft oder begrenzten Importmöglichkeiten aus, ist deutlich mehr Produktion aus Gaskraftwerken nötig (in einem Szenario bis zu 8 TWh im Winter).
Der Langzeitbetrieb eines bestehenden Kernkraftwerks könnte den Bedarf an Gaskraftwerken reduzieren (jeweils etwa 4 TWh in einem Szenario). Wenn die Ausbauziele des Stromgesetzes nicht erreicht werden, verdoppelt sich die Winterstromlücke, und der Bedarf an ergänzender Produktion steigt massiv. In diesem Fall wäre die Schweiz stark auf Gaskraftwerke angewiesen, die bis zu 18 TWh im Winterhalbjahr produzieren müssten. Dies würde das Erreichen der Klimaziele erschweren und verteuern. Werden die Stromgesetz-Ziele nicht erreicht, müssten in der Variante mit Kernkraftbetrieb sogar beide bestehenden Kernkraftwerke bis 2050 Strom liefern, um den Bedarf an Gaskraftwerken zu halbieren.
Neben Gaskraftwerken werden auch andere Massnahmen zur Sicherung der Winterversorgung genannt, wie die 16 Wasserkraftprojekte im Stromgesetz, mehr Windkraft, zusätzliche Importe und die Nutzung von Speichern und Flexibilitäten. Reservekraftwerke im Allgemeinen werden auch in anderen Kontexten zur Abfederung ausserordentlicher Engpässe erwähnt.
Reichen die Pumpspeicher-Kraftwerke in der Schweiz?
Pumpspeicherkraftwerke sind ein wichtiger Bestandteil des Schweizer Energiesystems und spielen eine zentrale Rolle für dessen Stabilität und Flexibilität. Sie tragen zur Versorgungssicherheit bei, insbesondere indem sie als flexible Kraftwerke die Balance zwischen Stromproduktion und Verbrauch aufrechterhalten und Teil der Wasserkraftreserve sind, die zur Überbrückung kritischer Engpässe gegen Ende des Winters genutzt wird. Die grossen Speicherkraftwerke (zu denen Pumpspeicher gehören) in den Alpen sind seit Jahrzehnten ein Rückgrat der Schweizer Stromversorgung.
Die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke werden allein nicht ausreichen, um alle zukünftigen Herausforderungen der Energieversorgung, insbesondere die Winterstromlücke, zu bewältigen. Ihre Effektivität kann beispielsweise durch trockene Sommer beeinträchtigt werden, die zu niedrigeren Wasserständen in Stauseen führen.
Die zukünftige Energieversorgung, die stark auf dezentrale erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Wind setzt, benötigt ein flexibles und intelligentes Netz sowie diverse Speicherlösungen. Pumpspeicher sind dabei ein Element, aber weitere notwendige Massnahmen wie der massive Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere solcher Anlagen, die auch im Winter Strom liefern (z.B. alpine PV, Windkraft) sind genauso wichtig.
Die Entwicklung und der Einsatz neuer, dezentraler Speichertechnologien wie Batteriespeicher, insbesondere zur Speicherung von lokal erzeugtem Solarstrom für den Eigenverbrauch oder zur Entlastung des lokalen Netzes müssen ausgebaut werden. Auch saisonale Speicher wie Wasserstoff werden als relevant für langfristige Schwankungen gesehen, im Gegensatz zu Batterien und Warmwassertanks für kürzere Zeiträume. Intelligente Netze (Smart Grids) und Energiemanagementsysteme zur besseren Steuerung und Nutzung von Flexibilitäten (z.B. bei E-Autos oder Wärmepumpen) werden dingend benötigt.
Die Diskussion um den Mantelerlass zeigt auch, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gab, ob Subventionen für neue Pumpspeicherkraftwerke notwendig oder die kostengünstigste Lösung sind, was ebenfalls impliziert, dass ihre Rolle im zukünftigen Mix neu bewertet wird und andere Lösungen an Bedeutung gewinnen.
Warum ist der Ausbau der Photovoltaik nötig?
Die Schweiz hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein (Netto-Null Treibhausgasemissionen). Um dieses Ziel zu erreichen, müssen fossile Energieträger durch erneuerbare, elektrische Energie ersetzt werden. Dieser Prozess der Elektrifizierung ist der Haupttreiber für den steigenden Strombedarf.
Der Stromverbrauch wird in Zukunft erheblich ansteigen. Gründe dafür sind die Umstellung von Heizungen auf elektrische Wärmepumpen und die Zunahme von Elektroautos im Verkehrssektor. Auch die Digitalisierung und Rechenzentren tragen zum erhöhten Bedarf bei. Laut einer VSE-Studie könnte der Landesstromverbrauch bis 2050 um rund 50 % auf etwa 90 TWh ansteigen.
Die Schweiz will langfristig aus der Kernenergie aussteigen. Die Produktion aus den bestehenden Kernkraftwerken muss durch neue, erneuerbare Kapazitäten ersetzt werden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
PV als tragende Säule der zukünftigen Stromversorgung.
Photovoltaik wird neben der Wasserkraft als die zukünftig tragende Säule der Schweizer Stromversorgung angesehen. Das neue Stromgesetz legt ambitionierte Ausbauziele fest, und die Photovoltaik soll einen Grossteil dieses Ziels ausmachen. Bis 2050 soll PV 40 % des Strombedarfs decken können, im Vergleich zu etwa 10 % heute. Die vorgesehene Leistung aller PV-Anlagen wird auf rund 40-50 GW geschätzt.
Alpine Solaranlagen der Schweiz.
Übersicht alpine Solaranlagen der Schweiz.
Alpine Solaranlagen - alle Artikel.
Die Energiestrategie 2050 führt zu einer
Veränderung der Netzstruktur, weg von wenigen grossen, zentralen Kraftwerken
hin zu vielen kleineren, dezentralen Produktionsanlagen wie PV auf Dächern und
Fassaden. Dies wird als dominantes Strukturmerkmal der Stromwirtschaft im Zuge
der Energiewende betrachtet. PV ist von Natur aus eine dezentrale Einspeisung.
Das Stromgesetz, das am 9. Juni 2024 angenommen wurde, legt verbindliche Zielwerte für den Ausbau erneuerbarer Energien fest. Es schafft zusätzliche Anreize für die Installation von PV auf Gebäuden und erleichtert temporär die Bewilligung von PV-Grossanlagen durch Initiativen wie die Solaroffensive (befristet bis Ende 2025). Es ist ein wichtiges Zeichen der Politik, den eingeschlagenen Weg zu unterstützen und zu beschleunigen.
Solaranlagen, insbesondere auf Hausdächern, ermöglichen einen hohen Anteil an Eigenverbrauch des produzierten Stroms. Dies reduziert den Bezug aus dem Netz und kann – besonders in Kombination mit Batteriespeichern oder intelligentem Lastmanagement – das lokale Stromnetz entlasten. Lokale Energiegemeinschaften (LEG) oder ZEVs fördern ebenfalls den lokalen Verbrauch und können das Netz entlasten.
Obwohl der starke PV-Zubau im Sommer zu Überschüssen führen kann und die Netzintegration Herausforderungen mit sich bringt, die Investitionen in Netzausbau und Digitalisierung erfordern, sowie flexible Lösungen wie Speicher und intelligentes Management nötig machen, ist der Ausbau der PV aufgrund des steigenden Gesamtstrombedarfs und der Klimaziele ein zwingender Schritt.
Die Bedeutung von ZEV - Zusammenschluss zum Eigenverbrauch.
Lokale Energiegemeinschaften, oft auch als ZEVs - Zusammenschluss zum Eigenverbrauch bezeichnet, können auf verschiedene Weise zur Versorgungssicherheit beitragen. Einer der Hauptvorteile von lokalen Energiegemeinschaften ist, dass sie den lokal produzierten Strom auch lokal verbrauchen. Indem der Strom direkt vor Ort genutzt wird, wird weniger Strom aus den übergeordneten Netzen bezogen, was die Netzbelastung reduziert und Übertragungsverluste minimiert. Dies ist besonders relevant in Zeiten hoher lokaler Produktion, wie zum Beispiel mittags bei Photovoltaik-Anlagen. ZEVs und lokale Netznutzungsmodelle werden als mögliche Wege gesehen, um den PV-Zubau zu fördern. Durch den lokalen Verbrauch und die Möglichkeit, auch ohne eigene Anlage direkt von einer lokalen Solaranlage Strom zu beziehen, wird die Nutzung von Solarenergie attraktiver. Dies trägt zum massiven Ausbau der erneuerbaren Energien bei, der für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele notwendig ist.
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV), virtueller ZEV und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG).
Lokale Gemeinschaften ermöglichen eine verbrauchernahe Energieproduktion, was ein dominantes Strukturmerkmal der Stromwirtschaft im Zuge der Energiewende ist. Sie können zur besseren Integration von volatilen erneuerbaren Energien beitragen, insbesondere wenn sie mit intelligenten Steuerungen, lokalen Speichern (wie Batterien oder potenziell E-Autos über bidirektionales Laden) und flexiblem Lastmanagement kombiniert werden. Dies ermöglicht ein netzdienliches Verhalten. Durch die lokale Optimierung von Erzeugung und Verbrauch und die Reduktion der Lastspitzen können lokale Energiegemeinschaften die Notwendigkeit für einen kostspieligen Netzausbau reduzieren. Sie tragen dazu bei, das Stromnetz effizienter zu nutzen und intelligenter zu steuern. Im Idealfall können lokale Anlagen Schwankungen ausgleichen und so die Zuverlässigkeit des Netzes verbessern. Ein virtuelles Kraftwerk, das dezentrale Erzeuger bündelt, kann Kosten beim Netzausbau sparen und hat Vorteile für alle Akteure.
Durch die lokale Optimierung und potenzielle Reduktion von Lastspitzen können ZEVs dazu beitragen, den Bedarf an kostspieligem Netzausbau zu reduzieren und das Stromnetz effizienter zu nutzen. Allerdings wird diskutiert, dass ohne entsprechende Tarifanreize wie Leistungstarife die Netzbelastung durch lokale Netznutzungsmodelle nicht tatsächlich reduziert wird. Ein virtuelles Kraftwerk, das dezentrale Erzeuger bündelt (was ZEVs einschliessen könnte), kann Kosten beim Netzausbau sparen.
Microgrids oder Arealnetze, die eine Form der dezentralen Versorgung darstellen, können im Normalbetrieb mit dem Netz verbunden sein, sich aber bei Bedarf zeitweise abkoppeln, um die Selbstversorgung zu gewährleisten. Dies erhöht die Unabhängigkeit von zentralen Kraftwerken und kann die Widerstandsfähigkeit (Resilienz) des Systems erhöhen. Allerdings bleibt das übergeordnete Netz als Backup unverzichtbar.
Dezentrale Versorgung in Microgrids.
Dezentrale Netze fördern die lokale Wertschöpfung und schaffen neue Arbeitsplätze in der Energiebranche. Sie ermöglichen eine breitere Teilhabe und Bürgerbeteiligung an der Energieversorgung und reduzieren potenziell die Abhängigkeit von Energieimporten.
Es ist jedoch zu beachten, dass die Bedeutung von lokalen Energiegemeinschaften für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien sehr unterschiedlich beurteilt wird. Während sie den lokalen Ausgleich von Angebot und Nachfrage verbessern können, können die benötigten riesigen Speicherkapazitäten für den saisonalen Ausgleich weder durch ZEVs noch durch lokale Nutzung realisiert werden. Dieser saisonale Ausgleich bleibt eine Herausforderung, die grössere Lösungen erfordert. Die Umsetzung des Potenzials von lokalen Energiegemeinschaften erfordert entsprechende Tarifanreize, die Digitalisierung und intelligente Steuerung des Netzes, sowie die Klärung von Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren (Verbraucher, Produzenten, Netzbetreiber, Politik).
Die Bedeutung von ZEVs wird im Rahmen der Energiewende politisch anerkannt. Das am 9. Juni 2024 angenommene Elektrizitätsgesetz ermöglicht die Entwicklung lokaler Elektrizitätsgemeinschaften (CEL). Es gibt Forschungsprojekte wie Boucl’ENER, die sich mit dem Potenzial solcher Zusammenschlüsse befassen. Es gibt jedoch auch unterschiedliche Beurteilungen ihrer Bedeutung für die sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Klärung des Rechtsrahmens ist notwendig, um das volle Potenzial für eine Kostenoptimierung und Netzverbesserung für die gesamte Gemeinschaft zu nutzen.
Welche Massnahmen muss die Schweiz unbedingt umsetzen?
Das am 9. Juni 2024 angenommene Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass) wird als wichtiger Schritt betrachtet, um den Ausbau der inländischen, erneuerbaren Stromproduktion und damit auch die Dezentralisierung zu beschleunigen. Die konsequente Umsetzung dieses Gesetzes ist zwingend notwendig. Die derzeit sehr langwierigen Bewilligungsverfahren für Netzausbau- und erneuerbare Energieprojekte (oft 15 Jahre und mehr, teils bis zu 30 Jahre) müssen deutlich verkürzt werden. Der sogenannte «Netzexpress» zielt darauf ab, dies zu erreichen, muss aber laut Verteilnetzbetreibern nicht nur auf das Höchstspannungsnetz, sondern auf allen Netzebenen beschleunigt werden. Auch der Ersatz bestehender Leitungen auf dem bisherigen Trassee sollte schneller erfolgen, idealerweise ohne umfassende Sachplanverfahren.
Die Dezentralisierung, insbesondere durch den Zubau von Photovoltaik und das Wachstum von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen, stellt neue und sich wandelnde Anforderungen an die Verteilnetze. Es sind erhebliche Investitionen in die Modernisierung und den physikalischen Ausbau der Infrastruktur auf den unteren Netzebenen (Mittel- und Niederspannungsnetz) unabdinglich. Das Netz muss für bidirektionale Stromflüsse ausgelegt sein. Ziel ist es, das Netz leistungsfähiger zu machen und es umzubauen.
Um mit der zunehmenden Komplexität des dezentralen Systems umgehen zu können, ist eine umfassende Digitalisierung und Automatisierung des Stromnetzes erforderlich. Dies ermöglicht die Sammlung und das Management von Millionen von Daten über den Netzzustand in Echtzeit. Intelligente Netze ermöglichen eine effiziente Integration dezentraler Energiequellen und erleichtern die Steuerung des Stromflusses. Smart Meter gelten als Grundlage für ein dynamisches Stromnetz.
Die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien erfordert die intelligente Erschliessung von Flexibilitäten. Dazu gehören dezentrale Stromspeicherlösungen wie Batterien oder die Nutzung von Elektrofahrzeugen über bidirektionales Laden (V2G) als temporäre Energiespeicher. Auch flexibles Lastmanagement und netzdienliches Verhalten der Verbraucher und Produzenten sind entscheidend. Ohne Zugang zu relevanten Flexibilitäten und Transparenz über den Netzzustand wird es schwierig, den stabilen Verteilnetzbetrieb bei angemessenen Kosten zu gewährleisten.
Die Stromtarife müssen sich an die neue Art der Netznutzung im dezentralen System anpassen. Tarife mit einem höheren Leistungsanteil werden als wichtig für eine sinnvolle Umsetzung von virtuellen ZEVs erachtet. Neue Anreize in der Regulierung, um Flexibilitäten zu nutzen und netzdienliches Verhalten zu fördern, sind notwendig und bereits in Verordnungsentwürfen enthalten.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren wie Verteilnetzbetreibern, Übertragungsnetzbetreibern (Swissgrid), Kraftwerksbetreibern, Kantonen und lokalen Partnern ist für eine erfolgreiche und effiziente Umsetzung von Netzprojekten und zur Bewältigung der Herausforderungen der Dezentralisierung unerlässlich.
Obwohl Dezentralisierung lokal Vorteile bringt, bleibt die Schweiz Teil des europäischen Stromnetzes. Eine engere Anbindung an das umliegende Stromsystem und der Abschluss eines Stromabkommens mit der EU sind entscheidend, um das Energiesystem robuster zu machen, mehr Kapazitäten für Importe und Exporte zu haben und die Versorgungssicherheit, insbesondere im Winter, zu verbessern.
Diese Massnahmen sind notwendig, um das Stromnetz fit für die Energiewende zu machen, den wachsenden Anteil dezentraler erneuerbarer Energien und die steigende Nachfrage durch Elektrifizierung zu integrieren und gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.
NOVA-Prinzip: Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau.
Der Netzausbau hat in der Schweiz nicht zwingend die erste Priorität. Der Netzausbau ist Teil einer breiteren Strategie zur Bewältigung der Energiewende, die verschiedene Massnahmen in einer bestimmten Reihenfolge vorsieht. Konkret verfolgt Swissgrid, die Betreiberin des Übertragungsnetzes, das NOVA-Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass die Reihenfolge der Massnahmen zur Netzentwicklung lautet: Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau. Ein physikalischer Netzausbau wird demnach erst eingeplant, wenn alle anderen Möglichkeiten im bestehenden Netz ausgeschöpft sind. Ziel ist es, den Einfluss auf Umwelt und Landschaft sowie die Kosten so gering wie möglich zu halten.
Auch für die Verteilnetze (insbesondere Netzebene 7) sind erhebliche Investitionen in die Modernisierung und den physikalischen Ausbau unumgänglich, da die dezentrale Einspeisung und die zunehmende Elektrifizierung (PV, E-Mobilität, Wärmepumpen) das Netz anders belasten als früher. In einigen Quartieren stösst das Netz bereits an seine Grenzen, sodass dort zuerst das Netz ausgebaut werden muss, bevor weitere PV-Anlagen angeschlossen werden können. Dies deutet auf eine notwendige Priorität des Ausbaus in spezifischen Engpassbereichen hin.
Der Netzausbau allein ist kein zielführender Ansatz. Stattdessen werden zusätzliche Massnahmen als entscheidend angesehen, um die Dezentralisierung zu stützen und den Bedarf an extensivem Netzausbau zu reduzieren:
Digitalisierung des Netzes (Smart Grids).
Ermöglicht intelligentes Management und Steuerung.
Erschliessung und Nutzung von Flexibilitäten.
Dezentrale Speicher (Batterien), bidirektionales Laden (V2G), flexibles Lastmanagement und netzdienliches Verhalten sind zentral, um die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien zu ermöglichen und den stabilen Netzbetrieb zu gewährleisten. Es wird argumentiert, dass dezentrales Lastmanagement und Speicher besser geeignet sind, viel PV zu integrieren als Netzausbau.
Smarte Integration dezentraler Anlagen.
PV-Anlagen, Ladestationen und Batteriespeicher müssen besser in das Verteilnetz integriert werden und eine aktivere Rolle in der Netzstabilisierung übernehmen. Dazu gehört auch die Ermöglichung von flexiblen Einspeiselimiten, um Anlagen anschliessen zu können, ohne sofort das Netz voll auszubauen. Es wird sogar gesagt, dass man mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht warten dürfe, bis die Netze bereit sind, sondern die Anlagen so bauen müsse, dass ein Grossteil des Netzausbaus gar nicht erst notwendig werde.
Anpassung der Tarifstrukturen.
Tarife mit höherem Leistungsanteil und neue Anreize in der Regulierung sind wichtig, um netzdienliches Verhalten zu fördern.
Der sogenannte "Netzexpress" zielt darauf ab, die sehr langwierigen Bewilligungsverfahren für Netzprojekte zu beschleunigen, was die Umsetzung notwendiger Ausbauprojekte erleichtern würde. Dies zeigt, dass der Netzausbau politisch als dringlich erachtet wird, aber es geht primär um die Prozessbeschleunigung, nicht darum, den Ausbau generell vor Optimierung oder Verstärkung zu stellen. Die plant Schweiz auf verschiedenen Netzebenen massive Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau, und dass dieser Ausbau in manchen Fällen dringend notwendig ist. Das offizielle Planungsprinzip von Swissgrid (NOVA) priorisiert jedoch die Optimierung und Verstärkung vor dem Ausbau. Darüber hinaus wird stark auf Digitalisierung, Flexibilitäten und intelligente Integration gesetzt, um den Ausbaubedarf zu minimieren und das Netz effizienter zu gestalten.
Was erschwert den Netzausbau in der Schweiz?

Bild: © Bruno Giordano
Es gibt mehrere Faktoren, die den Netzausbau in der Schweiz erschweren.
Langwierige Bewilligungsverfahren.
Dies wird als eines der Haupthindernisse genannt. Die Verfahren von der Projektierung bis zur Realisierung dauern oft 15 Jahre und mehr. In manchen Fällen können sich diese Prozesse durch Einsprachen und Gerichtsverfahren sogar bis zu 30 Jahre verlängern. Dies behindert die Transformation des Energiesystems und verhindert, dass der Netzausbau mit dem Ausbau der Stromproduktion (z.B. Kraftwerken) Schritt halten kann. Obwohl der sogenannte «Netzexpress» auf die Beschleunigung abzielt, sehen Verteilnetzbetreiber die Notwendigkeit einer Beschleunigung auf allen Netzebenen, nicht nur auf dem Höchstspannungsnetz [basierend auf Konversation zur Dezentralisierung]. Auch der Ersatz bestehender Leitungen auf dem bisherigen Trassee erfordert oft aufwendige Sachplanverfahren, deren Wegfall die Projektdauer verkürzen könnte.
Fehlende Akzeptanz für Netzprojekte und Konflikte mit anderen Interessen.
Der schleppende Ausbau der Stromnetze wird auch auf eine fehlende Akzeptanz für solche Projekte zurückgeführt. Netzprojekte, ähnlich wie grosse Produktionsprojekte, können Widerstand und Obstruktion hervorrufen. Es gibt Konflikte zwischen dem nationalen Interesse an einem starken Stromnetz und anderen nationalen Interessen wie Umwelt- und Landschaftsschutz. Obwohl das Stromgesetz grundsätzlich festlegt, dass das Interesse an der Realisierung von Übertragungsnetzanlagen anderen nationalen Interessen vorgehen soll, wenn Konflikte bestehen, führen diese Zielkonflikte und die resultierenden Einsprachen zu Verzögerungen. Auch die Debatte um Freileitungen versus Erdverkabelung kann eine Rolle spielen.
Der schiere Umfang und die Komplexität der notwendigen Investitionen.
Die Energiewende erfordert einen massiven physikalischen Ausbau und eine Modernisierung der Netzinfrastruktur, insbesondere auf den unteren Netzebenen (Verteilnetze). Die zunehmend dezentrale Einspeisung (insbesondere PV) und die Elektrifizierung von Mobilität (E-Autos) und Wärme (Wärmepumpen) stellen völlig neue Anforderungen an die Netze, die ursprünglich für die zentrale Einspeisung konzipiert wurden. Das Netz muss leistungsfähiger gemacht und umgebaut werden [basierend auf Konversation zur Dezentralisierung]. In einigen Quartieren stösst das Niederspannungsnetz bereits an seine Grenzen. Die erforderlichen Investitionen sind erheblich. Allein Swissgrid plant Investitionen von rund 5,5 Milliarden Franken bis 2040 in das Übertragungsnetz. EKZ investiert jede Woche fast 1.5 Millionen Franken in den Ausbau seines Versorgungsnetzes.
Physikalische Grenzen und technische Herausforderungen im Verteilnetz.
Die Physik setzt den Ausbauzielen Grenzen, insbesondere auf der Netzebene 7 (Niederspannungsnetz), wo viele neue Solaranlagen angeschlossen werden und im Sommer grosse Strommengen einspeisen. Das Verteilnetz war praktisch nicht automatisiert und statisch ausgelegt. Der Anspruch an Echtzeittransparenz und Steuerbarkeit wächst stark. Die Integration fluktuierender erneuerbarer Energien erfordert die Anpassung der Netze an bidirektionale Stromflüsse und die Gewährleistung von Spannungshaltung und -qualität, was lokale Netzengpässe und Lastspitzen vermeiden soll. Zwar können Massnahmen wie Digitalisierung, die Nutzung von Flexibilitäten und intelligente Steuerungen den Ausbaubedarf potenziell reduzieren, aber die notwendige Anpassung erfordert erhebliche Anstrengungen und Investitionen.
Rechtlicher Rahmen und Normen.
Historisch gesehen hatten die einzelnen Verteilnetzbetreiber (VNB) grossen Einfluss auf Regeln und Normen für den Netzanschluss. Mit der Zunahme von Anlagen mit nicht-europäischen Wechselrichtern wird es zunehmend unwahrscheinlich, dass internationale Hersteller auf die individuellen Anforderungen eines Schweizer Netzbetreibers eingehen. Das Einbringen der Schweizer Anforderungen in internationale Normen wird wichtiger. Auch fehlen laut einer Quelle die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen, um neue Preisgestaltungsmodelle (z.B. ortsabhängige Grenzkosten) umzusetzen, die zur Verbesserung der Netzauslastung und Kostensenkung beitragen könnten.
Diese Faktoren führen dazu, dass der notwendige Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes, obwohl politisch gewollt (z.B. Netzexpress), ein komplexes und langwieriges Unterfangen darstellen.
Wie hoch sind die geplanten Investitionen von Swissgrid bis 2040?
Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid plant, rund 5,5 Milliarden Franken bis zum Jahr 2040 in das Stromnetz zu investieren. Diese Investitionen sind notwendig, um das Übertragungsnetz für die künftigen Anforderungen fit zu machen, insbesondere aufgrund der Transformation des Energie- und Stromsystems, die durch die Dekarbonisierung, die Dezentralisierung der Stromerzeugung und die Digitalisierung vorangetrieben wird.
Swissgrid: Netz der Zukunft – Weiterentwicklung des Schweizer Höchstspannungsnetzes.
Das Schweizer Netz der Zukunft.
Die geplanten Massnahmen, die durch diese Investitionen finanziert werden sollen, umfassen:
Netzverstärkung und Netzausbau.
Auf 400 km des bestehenden Netzes soll eine Spannungs- oder Leistungserhöhung erfolgen, und auf 790 km werden neue Leitungen erstellt, um die Kapazität für die Stromübertragung zu erhöhen.
Regelbare Transformatoren.
Es werden 21 neue Phasenschiebertransformatoren (PST) beschafft und installiert, wovon 10 Ersatzbeschaffungen sind und 11 neu hinzukommen, um die Steuerbarkeit der Stromflüsse zu verbessern. Diese Transformatoren funktionieren wie ein Verkehrsleitsystem und helfen, Ströme gleichmässiger zu verteilen.
Optimierung bestehender Infrastruktur.
Auf circa 1300 km sind Sanierungsmassnahmen notwendig, da mehr als zwei Drittel des bestehenden Netzes älter als 60 Jahre ist. Die Gesamtlänge des Schweizer Übertragungsnetzes von 6700 km soll dabei gleich bleiben, da alte Leitungen auf 790 km zurückgebaut werden.
Diese Investitionen sind Teil der aktualisierten langfristigen Netzplanung von Swissgrid im Projekt "Strategisches Netz 2040", in dem 31 wesentliche Netzprojekte identifiziert wurden, die bis 2040 umgesetzt sein müssen. Das Ziel ist es, Engpässe zu beseitigen und einen sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzbetrieb zu gewährleisten.
Dezentralisierung erneruerbare Energien in der Schweiz.
SWEET Projekt EDGE (Enabling Decentralized renewable GEneration in the Swiss cities, midlands, and the Alps).
2.12.2025 Update
Bidirektionales Laden.
Bidirektionales Laden ist der Austausch elektrischer Energie in zwei Richtungen.
Es ermöglicht Elektrofahrzeugen (E-Autos), Strom nicht nur aufzunehmen, sondern diesen auch aus der Batterie abzugeben, wodurch das E-Auto zum mobilen Stromspeicher wird.
Drei Hauptanwendungsbereiche werden unterschieden:
1. Vehicle-to-Load (V2L) / Vehicle-to-Device (V2D): Das Fahrzeug gibt Strom im Inselbetrieb (nicht mit dem Stromnetz verbunden) ab, um elektrische Geräte, eine Gartenlaube oder einen Wohnwagen zu versorgen.
2. Vehicle-to-Home (V2H): Das E-Auto ist mit dem Hausnetz verbunden und speist gespeicherten Strom, oft aus der Photovoltaikanlage (PV), zurück ins Haus, um den Eigenverbrauch zu erhöhen und energieautark zu sein. Der Strom wird dabei nicht ins öffentliche Netz eingespeist.
3. Vehicle-to-Grid (V2G): Der Strom fließt vom Fahrzeug ins öffentliche Stromnetz. Dies ist die komplexeste Variante und dient primär der Stabilisierung des Stromnetzes und dem Ausgleich von Schwankungen.
Wirtschaftlicher und technischer Kontext (Deutschland):
Das Potenzial ist enorm: Die Batterien der aktuellen 1,5 Millionen E-Autos in Deutschland speichern bereits etwa 100 Gigawattstunden (GWh), was die Kapazität der Pumpspeicherkraftwerke (40 GWh) übersteigt.
V2H erhöht in Kombination mit PV und Heimspeichern den Autarkiegrad von Haushalten signifikant.
Technisch erfordert bidirektionales Laden die Umwandlung von Gleichstrom (DC) der Batterie in Wechselstrom (AC) für das Haus oder Netz mittels Wechselrichter. Dies geschieht entweder im Fahrzeug (AC-Lösung, z.B. demonstriert durch Bender mit ISO 15118-20) oder in einer bidirektionalen DC-Wallbox.
Der Kommunikationsstandard ISO 15118-20 ist für sichere, zukunftsfähige und interoperable V2G-Lösungen essenziell.
Die Kosten für bidirektionale DC-Wallboxen sind aktuell mit mindestens 4.000 € bis 6.000 € noch hoch.
Regulatorische Entwicklung (Deutschland):
Mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) Ende 2025 wurde der Weg für attraktiveres bidirektionales Laden freigemacht.
Ab dem 1. Januar 2026 sollen E-Autos wie stationäre Speicher behandelt werden, wodurch die doppelte Netzentgeltbelastung bei Rückspeisung entfällt, was eine große wirtschaftliche Hürde beseitigt.
Die Bundesnetzagentur plant ab dem 1. April 2026 die Einführung neuer MiSpeL-Prozessregeln, die die Bilanzierung, Messung und Abrechnung vereinfachen sollen, indem Wallboxen als Speichereinheiten behandelt werden.
Herausforderungen:
Garantie und Batterielebensdauer: Bidirektionales Laden verursacht zusätzliche Zyklen und Belastung. Hersteller wie Škoda/VW setzen harte Limits (z.B. 4.000 Stunden oder 10.000 kWh Entnahme). Die reguläre Batteriegarantie (z.B. 8 Jahre / 160.000 km) bleibt bei Einhaltung dieser Limits gültig.
Es fehlt noch an einem einheitlichen, herstellerübergreifenden System und der Klärung bürokratischer Fragen, z.B. zur steuerlichen Behandlung von Strom, der am Arbeitsplatz geladen und privat entladen wird.
Es wird erwartet, dass es noch mindestens drei bis vier Jahre dauern wird, bis ein marktreifer Durchbruch für jedermann erzielt wird.
Bidirektionales Laden wird als Schlüsseltechnologie der Energiewende betrachtet und soll die E-Mobilität von einem potenziellen Problem zu einer Lösung für die Netzstabilität wandeln.
Bidirektionales Laden.
E-Autos, bidirektionales Laden, mobiler Stromspeicher: Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Grid (V2G). Ermöglicht Elektrofahrzeugen (E-Autos), Strom nicht nur aufzunehmen, sondern diesen auch aus der Batterie abzugeben.
Bidirektionales Laden.
Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Besten Dank an Swissgrid für den Bilddownload.
Bild: Swissgrid Control, Netzleitstelle in Aarau.
@ Copyright Swissgrid
Quellenverzeichnis (21.5.2025)
https://www.swissgrid.ch/de/home/projects/future-grid.html
https://www.strom.ch/de/nachrichten/die-dezentralisierung-ist-vollem-gange
https://www.swissgrid.ch/de/home/newsroom/newsfeed/20250430-01.html
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dezentrale_Stromerzeugung
https://www.strom.ch/de/perspective/als-evu-4-ebenen-zum-intelligenteren-verteilnetz-der-zukunft
https://1komma5.com/de/magazin/strommarkt/dezentralisierung/
https://wyssmann.llc/dezentrale-energieversorgung-ein-lokalgeschaeft-mit-zukunft/
https://www.uhrig-bau.eu/lexikon/dezentralisierung-der-energieversorgung/
https://smartgrid-schweiz.ch/event/zev-mit-lokalem-verbrauch/
https://nfp-energie.ch/de/projects/umbrella/103/
https://www.ekz.ch/de/blue/wissen/2025/daniel-bucher-ekz-herausforderungen-stromnetz-interview.html
https://nfp-energie.ch/de/key-themes/198/synthese/15/cards/152
https://www.repower.com/ch/wissen/stromversorgung
https://www.baublatt.ch/baubranche/gefaehrden-klimaanlagen-das-stromnetz-36433
https://www.bfh.ch/dam/jcr:6c4037bd-a708-4941-b509-e6d06b0c4c4b/sweet-edge-discussion-paper.pdf
https://www.powernewz.ch/rubriken/versorgungssicherheit/
https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/energie/stromversorgungssicherheit.html

















