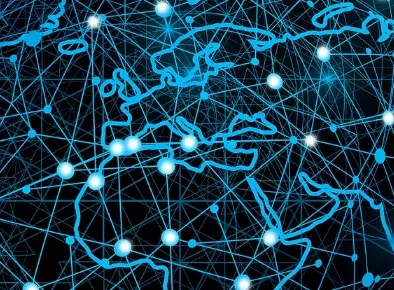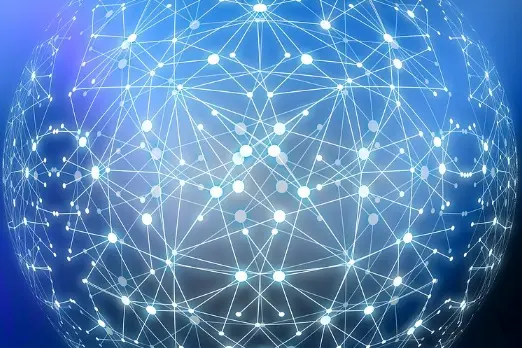Energiemix: Solar- und Windenergie sowie Elektrifizierung verdrängen fossile Energieträger in den Sektoren Verkehr und Wärme.
29.8.2025
Die Stromerzeugung und die Integration variabler erneuerbarer Energien in Stromnetze nimmt zu. Ein aktueller Vergleich der Anteile an der Stromerzeugung zeigt:
Anteile an der Stromerzeugung:
Kernkraft:
- Weltweit (2022): Die Kernkraft deckte rund 9 % des weltweiten Strombedarfs ab.
- EU (erstes Halbjahr 2024): Die Kernenergieerzeugung stieg in der EU um 3,1 % (+9 TWh) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zusammen mit erneuerbaren Energien machten CO2-arme Quellen 73 % der EU-Stromerzeugung aus.
- Deutschland: Deutschland ist aus der Kernenergie ausgestiegen, daher geht ihr Anteil auf null zurück.
- China und USA: Der Beitrag der Kernenergie in China ist relativ gering, nimmt aber leicht zu. In den USA bleibt er relativ konstant. Weltweit nimmt der relative Beitrag der Kernenergie ab.
Heizöl, Benzin, Diesel, Kerosin:
- Die bereitgestellten Quellen enthalten keine spezifischen, aktuellen Daten über die Anteile von Heizöl, Benzin, Diesel und Kerosin im allgemeinen Energiemix oder im Stromerzeugungsmix. Diese Brennstoffe werden hauptsächlich in anderen Sektoren wie Verkehr und Wärme eingesetzt.
Kohle:
- EU (erstes Halbjahr 2024): Die Kohleverstromung ging um 24 % (-39 TWh) zurück. Der gesamte fossile Anteil an der EU-Stromerzeugung lag bei 27 %.
- Deutschland (erstes Halbjahr 2024): Kohle lieferte 20 % des deutschen Stroms, ein Rückgang von 28 % (-19 TWh) gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.
- Polen (Mai 2024): Der Kohleanteil im polnischen Strommix erreichte ein Allzeittief von 57 %.
- Weltweit (2022): Fossile Energien stellten nach wie vor den "Löwenanteil" der Stromerzeugung dar.
Erdgas:
- EU (erstes Halbjahr 2024): Die Gaserzeugung sank um 14 % (-29 TWh) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. Der gesamte fossile Anteil an der EU-Stromerzeugung lag bei 27 %.
- Spanien (erstes Halbjahr 2024): Die Gaserzeugung sank um weitere 34 %.
- Allgemeiner Trend: Weltweit nimmt die fossile Stromerzeugung tendenziell ab.
Solarenergie und Windenergie (kombiniert):
- EU (erstes Halbjahr 2024): Solarenergie und Windenergie erzeugten 30 % des EU-Stroms und übertrafen damit erstmals die fossilen Brennstoffe (27 %). Der kombinierte Anstieg betrug 13 % (+45 TWh) im Vergleich zu H1-2023.
- Deutschland (aktuell): Wind- und Solarenergie haben einen Anteil von 60 % an der Stromerzeugung. Im Jahr 2024 erzeugten Photovoltaik und Windenergie bereits genauso viel Strom wie fossile Energieträger.
- Weltweit (2022): Wind- und Solarenergie deckten zusammen rund 12 % des weltweiten Strombedarfs ab.
- Allgemeiner Trend: Wind- und Solarenergie zeigen eine enorme Wachstumsdynamik, ihre Jahresproduktion steigt jährlich um rund 15 % bis 20 %, was einer Verdoppelung alle 4 bis 5 Jahre entspricht. Sie verdrängen stetig andere Stromerzeugungsformen. In Spanien wurden im Mai 2024 über 50 % des Stroms durch Wind- und Solarenergie erzeugt.
Solarenergie (einzeln):
- EU (erstes Halbjahr 2024): Die Solarerzeugung stieg um 20 % (+23 TWh).
- Deutschland (2024): Es wurden 100 GW an neuer Solarleistung installiert, was über dem Soll liegt. Die Solarerzeugung stieg um 14 % (+4.5 TWh) im H1-2024.
- Ungarn (erstes Halbjahr 2024): Die Solarerzeugung stieg um 49 % (+1.5 TWh).
Windenergie (einzeln):
- EU (erstes Halbjahr 2024): Die Winderzeugung stieg um 9,5 % (+21 TWh).
- Deutschland (erstes Halbjahr 2024): Die Winderzeugung stieg um 8,4 % (+5.5 TWh).
- Niederlande (erstes Halbjahr 2024): Die Winderzeugung stieg um 35 % (+4.6 TWh), bedingt durch erhebliche Kapazitätserweiterungen.
Gesamtenergiemix (Deutschland):
Die erneuerbaren Energien liegen im Gesamtenergiekuchen (nicht nur Strom) in Deutschlands bei etwa 21 %.
Wie steht es mit Solar- und Windenergie in der Schweiz?
Anteile Solar- und Windenergie in der Schweiz.
Die Erkenntnisse über das schnelle Wachstum und die Kostenreduktion von Solar- und Windenergie lassen sich nicht direkt auf die Stromproduktion in der Schweiz übertragen. Als Hauptgrund gilt, dass die Schweiz zu wenig verfügbare Fläche für den grossflächigen Ausbau dieser erneuerbaren Energien hat. Die Schweizer Stromproduktion muss wohl daher auch in Zukunft subventioniert werden muss, um mit der europäischen Stromproduktion konkurrenzfähig zu bleiben, ähnlich wie es heute in der Landwirtschaft der Fall ist.
Welche Energieart wird sich durchsetzen?
Solarenergie und Windenergie.
Zukunftsenergie und Durchbruchsinnovation:
Photovoltaik und Windenergie werden als "Durchbruchstechnologien" bezeichnet, die anderen überlegen sind und sich im Markt durchsetzen werden. Solarenergie wird explizit als die wichtigste Energiequelle der Zukunft hervorgehoben, die letztlich auch die Energie des Windes und der Wasserkraft antreibt.
Exponentielles Wachstum und Kostenreduktion:
Ihre Jahresproduktion erhöht sich jährlich um rund 15 % bis 20 %, was einer Verdoppelung alle 4 bis 5 Jahre entspricht. Die durchschnittlichen Kosten für Solar- und Windenergie sind zwischen 2010 und 2022 massiv gesunken (ca. 89 % für Solar und 67 % für Wind), was eine positive Rückkopplungsschleife erzeugt: Sinkende Kosten führen zu steigender Nachfrage und Produktion, was wiederum die Kosten senkt. Dadurch beschleunigt sich der Ausbau dieser Technologien mittlerweile von alleine.
Marktdominanz und Verdrängung fossiler Energien:
Die installierte Kapazität von Solar-PV und Wind hat sich von 2018 bis 2023 mehr als verdoppelt, und ihr Anteil an der weltweiten Stromerzeugung hat sich fast verdoppelt. Im ersten Halbjahr 2024 deckten sie in der EU bereits 30 % des Strombedarfs und übertrafen damit erstmals die fossilen Brennstoffe. In Deutschland haben Wind- und Solarenergie inzwischen einen Anteil von 60 % an der Stromerzeugung, und im Jahr 2024 erzeugten sie bereits genauso viel Strom wie fossile Energieträger. Weltweite Verpflichtungen wie das COP28-Ziel sehen vor, die globale Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen, wobei Solar-PV und Windenergie voraussichtlich 92 % dieses Anstiegs ausmachen werden. Bei anhaltendem exponentiellem Wachstum könnten sie die fossile Stromproduktion bis 2035 um ganze 60 % senken.
Erdgas.
Abnehmende Rolle in der Stromerzeugung:
Die Gaserzeugung in der EU sank im ersten Halbjahr 2024 um 14 %. Weltweit nimmt der Beitrag fossiler Energien zur Stromerzeugung tendenziell ab.
Übergangsrolle zur Dekarbonisierung:
Erdgas wird weiterhin als Teil des Energiespektrums der IEA betrachtet. Deutschland plant jedoch den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken, die in einem gestuften Ansatz auf Wasserstoff umgestellt werden sollen, was auf eine Übergangsrolle im Zuge der Dekarbonisierung hindeutet.
Kernkraft.
Relativ konstanter, aber abnehmender globaler Beitrag:
Der Beitrag der Kernenergie zum weltweiten Strombedarf lag 2022 bei rund 9 % und ist damit geringer als der kombinierte Anteil von Wind- und Solarenergie (12 %). Global gesehen nimmt der relative Beitrag der Kernenergie eher ab oder bleibt konstant.
Keine Durchbruchstechnologie:
Kernenergie wird nicht als Durchbruchstechnologie angesehen, die andere Stromerzeugungsformen ersetzt. Die Kosten für Kernkraftwerke sinken tendenziell nicht mit zunehmender Fertigung, im Gegensatz zu den positiven Lernkurven von Solar-PV und Windenergie.
Spezifische Anwendung:
Sie kann als kohlenstoffarme Erzeugungsquelle zur Deckung von Defiziten bei variablen erneuerbaren Energien dienen, insbesondere in Systemen mit begrenzten Verbundmöglichkeiten.
Kohle.
Starker Rückgang und Ausphasung:
Die Kohleverstromung in der EU ging im ersten Halbjahr 2024 um 24 % zurück. Bis Ende 2023 hatten mindestens 84 Länder zugestimmt, Kohle auslaufen zu lassen. Selbst in Polen, das stark von Kohle abhängig ist, erreichte der Kohleanteil im Mai 2024 ein Allzeittief von 57 %.
Wirtschaftliche Benachteiligung:
An vielen Orten ist Wind- und Solarenergie mittlerweile günstiger als Kohlekraft. Obwohl Länder wie China weiterhin Kohlekraftwerke bauen, wachsen Photovoltaik und Windenergie dort wesentlich stärker und verdrängen die Kohlestromerzeugung prozentual.
Heizöl, Benzin, Diesel, Kerosin.
Verdrängung durch Elektrifizierung:
Die bereitgestellten Quellen konzentrieren sich primär auf die Stromerzeugung und enthalten keine spezifischen, aktuellen Daten über die Anteile dieser einzelnen Brennstoffe im gesamten Energiemix. Sie sind jedoch als fossile Energieträger Teil der Sektoren (Verkehr, Wärme), in denen eine tiefgreifende Umstellung auf erneuerbare Energien und Elektrifizierung (z.B. Elektromobilität, Wärmepumpen) erwartet wird. Dies impliziert eine abnehmende Bedeutung dieser Brennstoffe im zukünftigen Energiemix, da Wasserstoff und Strom zunehmend für Mobilität und Industrieprozesse genutzt werden sollen.
Rechtzeitige Integration von Solar-PV- und Windkapazitäten.
Die rechtzeitige Integration von Solar-PV- und Windkapazitäten, um die globalen Dekarbonisierungsziele zu erreichen sind weiterhin wichtige Ziele. Zwischen 2018 und 2023 haben sich die installierten Kapazitäten von Solar-PV und Wind mehr als verdoppelt, und ihr Anteil an der globalen Stromerzeugung hat sich fast verdoppelt. Diese Technologien werden voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des steigenden Strombedarfs bis 2030 leisten. Allerdings warnt die IEA, dass bis zu 15% der Solar-PV- und Windstromerzeugung bis 2030 gefährdet sein könnten, wenn Länder keine entsprechenden Integrationsmassnahmen umsetzen. Dies könnte zu einer bis zu 20% geringeren Reduzierung der CO2-Emissionen im Stromsektor führen, falls die Lücke durch fossile Brennstoffe kompensiert wird.
Hintergrund und Treiber der Energiewende:
Die globale Energielandschaft erlebt eine beispiellose Expansion der variablen erneuerbaren Energien (VRE), angetrieben durch sinkende Kosten und immer ehrgeizigere Regierungs- und multilaterale Politiken. Das COP28-Versprechen, die globale Kapazität erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen, unterstreicht dieses Engagement. Erneuerbare Energien sind nicht nur entscheidend für die Dekarbonisierung des Stromsektors, sondern verbessern auch die Energiesicherheit und -bezahlbarkeit, indem sie die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren.
Herausforderungen der Integration von variablen erneuerbaren Energien (VRE):
Die Integration von Solar-PV und Wind in Stromsysteme erfordert technische, institutionelle, politische und marktbezogene Anpassungen. VRE-Anlagen bringen spezifische Eigenschaften mit sich, die Anpassungen erfordern:
Variabilität und Unsicherheit:
Die Stromerzeugung von Solar und Wind schwankt stark mit den Wetterbedingungen, was die Planung erschwert.
Räumliche Diskrepanz:
Anlagen der variablen erneuerbaren Energien befinden sich oft weit entfernt von Verbrauchszentren, was einen Ausbau der Übertragungsinfrastruktur erfordert.
Dezentralisierung:
Viele kleine, verteilte Anlagen der variablen erneuerbaren Energien (z.B. Dachanlagen) erschweren einen umfassenden Überblick und Kontrolle.
Nicht-synchrone Einspeisung:
variable, erneuerbare Energien-Anlagen sind über Leistungsumrichter an das Netz angeschlossen, die nicht die gleichen netzstabilisierenden Eigenschaften wie traditionelle synchrone Generatoren (z.B. Kohle, Gas, Kernkraft, Wasserkraft) bieten. Dies kann Herausforderungen bei der Frequenz- und Spannungsregelung verursachen.
Netzbildende Wechselrichter der ETH Zürich.
Netzanschlusswarteschlangen und Engpässe:
Bedenken hinsichtlich der Integration, wie lange Wartezeiten für den Netzanschluss und Engpassmanagement, schrecken Investitionen ab und verursachen Verzögerungen und Unsicherheit.
Phasenmodell der Internationalen Energieagentur IEA.
Die IEA hat ein Phasenmodell für die Integration der variablen erneuerbaren Energien entwickelt. Es ist ein Rahmenwerk mit sechs Phasen der Integration von variablen erneuerbaren Energien, das die zunehmenden Systemauswirkungen von Solar-PV und Wind beschreibt, jede mit spezifischen Herausforderungen und Lösungen.
Phase 1-3 (Niedrige Phasen):
Variable erneuerbare Energien haben keine oder geringe bis moderate Auswirkungen auf das System.
Herausforderungen können durch einfache Anpassungen bestehender Anlagen oder operative Verbesserungen zur Erhöhung der Flexibilität bewältigt werden. Die meisten neuen VRE-Kapazitäten bis 2030 werden in Systemen mit niedriger Integration angesiedelt sein, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern.
Integration in diesen Phasen ist oft durch gezielte und schrittweise Massnahmen möglich, die auf umfangreicher globaler Erfahrung basieren.
Phase 4-6 (Hohe Phasen):
Variable erneuerbare Energien bestimmen den Betriebsablauf des Stromsystems, decken zeitweise fast den gesamten Bedarf oder führen zu Überschüssen. In diesen Phasen werden die Herausforderungen in Bezug auf Stabilität und Flexibilität über alle Zeitrahmen hinweg akuter. Sie erfordern eine grundlegende Transformation der Betriebsweise, Planung und Finanzierung der Stromsysteme.
Phase 4:
Variable erneuerbare Energien decken zeitweise fast den gesamten Bedarf; Hauptproblem ist die Systemstabilität bei hoher VRE-Penetration und pervasive Netzengpässe.
Phase 5:
Signifikante Überschüsse der variablen erneuerbaren Energien über das ganze Jahr; Herausforderung ist das effiziente Management von langen Perioden mit geringen oder hohen Anteilen variabler erneuerbarer Energien. Dänemark und Südaustralien sind Beispiele für Systeme in Phase 5. Überschüsse können primär eine ökonomische Herausforderung darstellen, da sie die Strompreise senken und somit das Geschäftsmodell neuer Projekte variabler erneuerbarer Energien untergraben können.
Phase 6:
Sichere Stromversorgung fast ausschliesslich durch variable erneuerbare Energien; aktuell kein grosses System in dieser Phase. Hier werden Strategien für erweiterte Überschüsse und Defizite sowie Systemdienstleistungen kritisch. Globale Bestandsaufnahme der Integrationsmassnahmen: Die Studie präsentiert eine erste umfassende Bestandsaufnahme der Integrationsmassnahmen in 50 Stromsystemen weltweit, die fast 90% der globalen Solar-PV- und Windstromerzeugung abdecken.
Allgemeine Massnahmen (Phasen 1-3):
Verbesserung der Kraftwerksfähigkeiten:
Nachrüstung konventioneller Kraftwerke für mehr Flexibilität und Erhöhung technischer Anforderungen an VRE-Anlagen.
Verbesserung der Prognosegenauigkeit:
Für Erzeugung variabler erneuerbarer Energien, Netto-Last und Leistungsflüsse, um operative Schwierigkeiten zu vermeiden und die Energiesicherheit zu gewährleisten.
Mobilisierung von Nachfragereserven (Demand Response):
Insbesondere durch industrielle Verbraucher, die erhebliche und konzentrierte Energienutzung haben. Auch kommerzielle und private Nachfrage ist relevant.
Kosteneffiziente und flexibilitätsfördernde Dispatch-Verfahren:
Einsatz von Least-Cost-Dispatch, Abbau von Verzerrungen durch Subventionen und vertragliche Beschränkungen, Einführung von Bilanzierungs- und Zusatzleistungs-Märkten.
Verbesserung der Netzkapazität und -nutzung:
Netzverstärkung, verbesserte Interkonnektion und Leistungsflusssteuerung. Massnahmen in hohen Phasen (Phasen 4-6): Hier sind tiefgreifendere Transformationen in der Systemplanung, -betrieb und -finanzierung erforderlich.
Systemstabilität:
Problem:
Reduzierung der physikalischen Trägheit, Schwächung der Spannungsform und Verringerung der Kurzschlussströme durch den Ersatz synchroner Generatoren durch VRE-Anlagen.
Lösungen:
Einsatz von synchronen Kondensatoren und STATCOMs zur Erhöhung der Systemstabilität. Moderne netzbildende (grid-forming, GFM) Umrichter können Spannungsformen erzeugen und zur Netzstabilität beitragen, sind jedoch noch nicht in grossem Massstab für VRE-Anlagen verbreitet. Anpassung von Netzcodes und Betriebsverfahren zur Erhöhung der RoCoF-Anforderungen.
Neue Systemdienstleistungen:
Einführung von Fast Frequency Response (FFR) und gezielten Auktionen für Stabilitätsdienstleistungen.
Flexibilität:
Problem:
Erhöhter Flexibilitätsbedarf über alle Zeitskalen (stündlich, wöchentlich, saisonal) aufgrund von Variabilität variabler erneuerbarer Energien und sich ändernder Nachfragestruktur.
Lösungen:
Speicherlösungen:
Batteriespeichersysteme (BESS) sind reif und nehmen exponentiell zu, um kurzfristige Flexibilität zu liefern. Langzeitspeicher wie Pumpspeicherkraftwerke.
Interkonnektoren:
Grenzüberschreitende Verbindungen können saisonale und kurzfristige Flexibilitätsbedürfnisse erheblich mindern.
Sektorkopplung:
Flexible Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion können langfristige Flexibilität bieten.
Sektorkopplung in der Schweiz.
Nachfrageseite:
Intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen (EVs) und andere smarte Geräte, die durch zeitvariable Tarife und digitale Steuerungssysteme aktiviert werden.
Transformation von Regeln, Vergütung und Planung:
- Vergütungsmechanismen: Einführung von Kapazitätsmechanismen und Energy-Price-Adders, um die Investitionen in flexible, zuschaltbare Ressourcen zu sichern, da die Marktpreise bei hoher VRE-Penetration volatiler werden.
- Systemfreundliche Verträge und Förderprogramme: Um die VRE-Bereitstellung zu fördern, sollten Verträge wie Contracts for Difference (CfDs) und Power Purchase Agreements (PPAs) so gestaltet werden, dass sie systemfreundliches Verhalten incentivieren (z.B. durch Vermeidung von "Must-Run"-Klauseln und Maximierung der Einspeisung unabhängig von Marktpreisen).
- Proaktive und robuste Planung: Einsatz von integrierter und koordinierter Planung, die Szenario-basierte Analysen, Sensitivitätsanalysen und stochastische Methoden verwendet, um die Unsicherheiten des sich wandelnden Energiesystems zu berücksichtigen.
System-Archetypen:
Die Studie identifiziert "System-Archetypen", die ähnliche Merkmale aufweisen und unterschiedliche Integrationsansätze erfordern:
Insel- und Quasi-Insel-Systeme (I) vs. Grosse vernetzte Systeme (X):
Insel-Systeme haben begrenzte Flexibilitätsressourcen und legen Wert auf die Verbesserung konventioneller Kraftwerke, technische VRE-Standards und Batteriespeicher. Grosse vernetzte Systeme nutzen ihre Vielfalt durch verstärkte Interkonnektion und Koordinierung.
Vermaschte Systeme (M) vs. Sparsam verbundene Systeme (S):
Vermaschte Systeme (hohe Redundanz) konzentrieren sich auf die Effizienz durch Marktbeschaffung von Flexibilität. Sparsam verbundene Systeme (geringe Redundanz) setzen auf VRE-Abregelung und Hilfseinrichtungen zur Stabilität.
Utility-Scale VRE-dominierte Systeme (U) vs. Dezentral dominierte Systeme variabler erneuerbarer Energien (D):
Systeme mit grossen VRE-Anlagen legen Wert auf Netzverstärkung und Systemdienstleistungen von den Anlagen selbst. Systeme mit vielen kleinen VRE-Anlagen konzentrieren sich auf flexible Systemlösungen und Verteilnetzverstärkung.
Spezielle Fokusbereiche:
VRE-Abregelung (Curtailment):
Kann technisch (Netzengpässe) oder wirtschaftlich (Preisignale) sein. Hohe Abregelungsraten können Investitionen in variable erneuerbare Energien untergraben und CO2-Emissionen erhöhen. Lösungen umfassen Flexibilitätsverbesserungen, Entschädigungssysteme und flexible Anschlussverträge. Bei sehr hohen Anteilen variabler erneuerbarer Energien kann ein gewisses Mass an Abregelung jedoch kosteneffizient sein.
Netzanschlusswarteschlangen:
Länder wie die USA, Australien und Brasilien haben mit Reformen, Renewable Energy Zones (REZs) und neuen Übertragungsprojekten auf Verzögerungen reagiert.
Politische Massnahmen:
Politiker müssen die Implementierung von VRE-Integrationsmassnahmen priorisieren, die für ihre jeweiligen Herausforderungen relevant und effektiv sind.
Universelle Massnahmen (unabhängig von der Phase):
Systemverständnis verbessern, Netzinfrastruktur modernisieren, solide Datengrundlagen schaffen, klare Anreize setzen und qualifizierte Arbeitskräfte aufbauen.
Massnahmen für niedrige Phasen (1-3):
Prognosegenauigkeit verbessern, VRE-Daten für Transparenz und Steuerbarkeit bereitstellen, Netzcodes einführen, Dispatch-Praktiken verbessern, industrielle Nachfrage als Flexibilitätsquelle mobilisieren, Nachrüstung von Wärmekraftwerken für flexibleren Betrieb.
Massnahmen für hohe Phasen (4+):
VRE-Integrationstechnologien mit starker regulatorischer Unterstützung einsetzen, Vergütungssysteme entsprechend dem Systemwert anpassen, Unternehmenseigene Strombeschaffung positiv zur Transformation beitragen lassen, sich auf benötigte Dienstleistungen statt spezifische Technologien konzentrieren, Stromsystem ganzheitlich planen und regulieren, Angemessenheitsbewertungen an den stochastischen und regionalen Charakter von Stromsystemen anpassen, Demonstrationsprojekte und regulatorische Sandboxes fördern, Programme zur Nachfrageseitenflexibilität ausweiten und internationalen Wissensaustausch fördern.
Die meisten Länder, die ihre Solar-PV- und Windkapazitäten ausbauen können, müssen schrittweise Integrationsmassnahmen implementieren. Verzögerungen bei diesen Massnahmen gefährden erhebliche Mengen an sauberer Energie und die Erreichung der Klimaziele.
Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.
Wind- und Solarenergie auf Überholkurs.
Im ersten Halbjahr 2024 haben Wind- und Solarenergie in der EU erstmals die fossilen Brennstoffe bei der Stromerzeugung übertroffen. Der Bericht "Wind and solar overtake EU fossil fuels in the first half of 2024", veröffentlicht am 30. Juli 2024 von Euan Graham und Nicolas Fulghum, beleuchtet diese historische Verschiebung und die treibenden Faktoren.
Wesentliche Ergebnisse im ersten Halbjahr 2024:
- Anteil von Wind- und Solarenergie: Erreichte 30% der EU-Stromerzeugung.
- Anteil fossiler Brennstoffe: Sank auf 27% der EU-Stromerzeugung.
- Rückgang der fossilen Erzeugung: Fiel um 17% (-71 TWh) im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 und erreichte ein Allzeittief.
- CO2-Emissionen: Die Emissionen im Stromsektor waren fast ein Drittel (-31%) niedriger als im ersten Halbjahr 2022, was einen beispiellosen Rückgang in so kurzer Zeit darstellt.
- Stromnachfrage: Erholte sich um 0,7% (+9 TWh) nach zwei Jahren des Rückgangs, wurde jedoch durch einen milden Winter begrenzt.
- Historischer Meilenstein: Wind- und Solarenergie erzeugten zusammen mehr Strom als fossile Brennstoffe in dreizehn Mitgliedstaaten, wobei Deutschland, Belgien, Ungarn und die Niederlande dies erstmals im Zeitraum Januar bis Juni 2024 erreichten.
Detaillierte Analyse der Stromerzeugung:
Rückgang der fossilen Brennstoffe:
Der Rückgang der fossilen Erzeugung war der grösste Treiber der Emissionssenkungen.
- Kohle: Fiel um ein Viertel (-24%, -39 TWh).
- Gas: Sank um 14% (-29 TWh).
- Über 75% des Rückgangs der fossilen Erzeugung stammten aus nur fünf Mitgliedstaaten:
- Deutschland: Fossilien sank um 19 TWh (-16%), hauptsächlich durch einen Rückgang der Kohleerzeugung um 28% (-19 TWh).
- Italien: Rückgang um 14 TWh (-21%), gleichmässig verteilt auf Kohle und Gas.
- Spanien, Frankreich, Belgien: Verzeichneten starke Rückgänge bei der Gaserzeugung. In Spanien sank die Gaserzeugung im ersten Halbjahr 2024 um weitere 34%.
- Polen: Der Kohleanteil erreichte im Mai 2024 mit 57% ein Allzeittief.
- Wachstum von Wind- und Solarenergie:
Solarerzeugung:
Stieg um 20% (+23 TWh). Dieses Wachstum war in Deutschland (+4,5 TWh, +14%), Spanien (+2,7 TWh, +13%), Italien (+2,6 TWh, +17%) und Polen (+2,4 TWh, +37%) besonders ausgeprägt. Ungarn verzeichnete mit 49% (+1,5 TWh) das schnellste relative Wachstum.
Winderzeugung:
Stieg um 9,5% (+21 TWh). Fast die Hälfte des Windwachstums stammte aus Deutschland (+5,5 TWh, +8,4%) und den Niederlanden (+4,6 TWh, +35%).
Wasserkraft:
Erholte sich um 21% (+33 TWh) und erreichte den höchsten Stand seit 2018, nach mehreren Dürrejahren.
Insgesamt deckten erneuerbare Energien (Wind, Solar, Wasserkraft und Biomasse) 50% der EU-Stromerzeugung im ersten Halbjahr 2024 ab, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresrekord von 44%. Zusammen mit der Kernenergie machten kohlenstoffarme Quellen fast drei Viertel (73%) der EU-Stromerzeugung aus.
Einfluss von Wetterbedingungen und strukturellem Wachstum:
Milde Wintertemperaturen und gute Windverhältnisse sowie die Erholung der Wasserkraft trugen zum Rückgang der fossilen Erzeugung bei.
Die Sonneneinstrahlung war im ersten Halbjahr 2024 etwas geringer, was ein noch schnelleres Solarwachstum verhinderte. Trotzdem übertraf das strukturelle Wachstum von Wind und Solar die steigende Nachfrage.
Meilensteine und strukturelle Veränderungen:
Das Übertreffen der fossilen Stromerzeugung durch Wind und Solar in der EU ist ein historischer Wendepunkt, der eine dauerhafte strukturelle Veränderung signalisiert.
Vor fünf Jahren übertrafen Wind und Solar nur in 5 von 27 Mitgliedstaaten die fossile Erzeugung (25% der EU-Nachfrage); im ersten Halbjahr 2024 waren es 13 Mitgliedstaaten (70% der EU-Nachfrage).
Zusätzliche Meilensteine waren der Anteil von über 50% Wind- und Solarstrom in Spanien im Mai und der Anteil von einem Drittel in Polen im selben Monat, jeweils zum ersten Mal.
Treiber des Kapazitätsbooms:
Die Beschleunigung des Ausbaus von Wind und Solar wurde durch unterstützende politische Massnahmen (wie den REPowerEU-Plan) und die Energiekrise (Russlands Invasion in der Ukraine, hohe Gaspreise) vorangetrieben.
Sinkende Kosten für Solarmodule unterstützten den Ausbau weiterhin. Im Jahr 2023 wurden Rekorde bei den Zubauten von Wind- und Solarkapazitäten in der EU verzeichnet. Beispiele sind die deutschen Reformen für Bürokratieabbau und Anreize für Dachsolaranlagen, das neue Offshore-Windfeld Hollandse Kust Noord in den Niederlanden und neue Subventionen in Österreich.
Herausforderungen und Ausblick:
Für 2024 werden weitere erhebliche Zubauten erwartet (15,8 GW Wind, 62 GW Solar), was eine dauerhafte Verschiebung weg von fossilen Brennstoffen bedeutet. Selbst unter ungünstigen Bedingungen (schwächste Wasserkraftleistung, schnellstes Nachfragewachstum) würden Wind und Solar die fossile Erzeugung im ersten Halbjahr 2025 übertreffen.
Um dieses Tempo der Energiewende aufrechtzuerhalten, sind jedoch gezielte politische Massnahmen erforderlich, um Barrieren wie Netzanschlussbeschränkungen und Integrationsprobleme abzubauen.
Die Wachstumsrate der jährlichen Solarzubauten wird voraussichtlich auf unter 20% sinken, und bei Wind wird die EU voraussichtlich 30 GW hinter dem Ziel von 425 GW für 2030 zurückbleiben.
Angesichts der Rückkehr der Strompreise auf Vorkrisenniveau kann sich Europa nicht allein auf den Markt verlassen; gut konzipierte Anreizsysteme und die Überwindung nicht-marktlicher Barrieren wie Netzkapazitätsengpässe sind unerlässlich.
Methodologie:
Die Daten des Berichts wurden von Ember kuratiert.
Monatliche Erzeugungs-, Import- und Nachfragedaten stammen von ENTSO-E, nationalen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNBs) und Eurostat.
Die Analyse der Wetterbedingungen basierte auf Ländertemperaturdaten aus dem ERA5-Datensatz, um temperaturangepasste Nachfrageänderungen zu schätzen.
Für Wind und Solar wurden Windgeschwindigkeits- und Sonneneinstrahlungsdaten aus dem ERA5-Datensatz verwendet, um simulierte Kapazitätsfaktoren zu berechnen und strukturelle sowie witterungsbedingte Veränderungen zu identifizieren.
Zukunftsenergie und die Rolle erneuerbarer Energien.
Zukunftsenergie ist primär die Energie der Sonne, die auch Wind- und Wasserkraft antreibt. Sie ist die wichtigste Energiequelle der Zukunft und fällt verteilt an, z.B. auf Dächern. Solarenergie wird in Strom umgewandelt (für Fahrzeuge, Industrie), in Wasserstoff (für Fortbewegung, Industrieprozesse) und zur Gebäudeheizung (Wärmepumpen) genutzt. Auch Geothermie ist eine wichtige Energiequelle.
Erneuerbare Energien als technologische Revolution: Die Menschheit befindet sich inmitten einer technologischen Revolution, vergleichbar mit der Industrialisierung, der Einführung der Dampfmaschine, dem Aufkommen des Automobils oder dem IT-Zeitalter. Diese Revolution wird durch erneuerbare Energien – Solar, Wind und Batterien – angetrieben, welche die zentrale Technologien für den Klimaschutz sind.
Dominanz von Solar- und Windenergie auf dem Strommarkt.
Exponentielles Wachstum und Marktdurchbruch:
Diffusionskurve:
Technologien verbreiten sich im Markt nach dem Prinzip der "Diffusion von Innovationen", oft beschrieben durch eine S-förmige Kurve, beginnend mit Innovatoren, gefolgt von Early Adopters, Early Majority, Late Majority und Nachzüglern.
Globale Entwicklung:
Seit Jahrzehnten zeigen Wind- und Solarenergie eine enorme Wachstumsdynamik, ihre Jahresproduktion steigt jährlich um 15% bis 20%. Sie haben 2022 zusammen etwa 12% des weltweiten Strombedarfs gedeckt und damit die Atomkraft (9%) überholt. Fossile Energien machen jedoch immer noch den Löwenanteil aus.
Verdrängung anderer Energieformen:
In Deutschland, China, den USA und global nehmen die Anteile der fossilen Stromerzeugung ab, während Kernenergie stagniert (oder abnimmt). Photovoltaik und Wind wachsen stetig und verdrängen andere Stromerzeugungsformen.
Zukunftsprognose:
Wenn Solar- und Windenergie weiterhin exponentiell wachsen (eine Verdopplung alle 4 bis 5 Jahre), könnten sie bis 2035 die fossile Stromproduktion um 60% senken, was ein entscheidender Schritt zum Netto-Null-Ziel bis 2050 wäre.
Gründe für das Wachstum – Positive Rückkopplung:
Negative Lernkurve und Kostensenkung:
Die Produktionskosten von Solar-, Wind- und Batterietechnologien sind in den letzten 10 Jahren massiv gesunken. Mit jeder Verdopplung der Produktionskapazität sinken die Kosten für Photovoltaik um über 20%. Kernenergie zeigt diesen Effekt hingegen nicht.
Wirtschaftlichkeit:
Wind- und Solarenergie sind an vielen Orten bereits günstiger als Kohlekraft, was den Ausbau ohne Subventionen beschleunigt. Dies schafft eine positive Spirale: mehr Produktion führt zu besseren, effizienteren und günstigeren Technologien, was wiederum zu mehr Installationen führt.
Einfachheit der Technologie:
Photovoltaik ist eine relativ einfache Technologie, was diese Kostensenkungen durch Massenfertigung ermöglicht.
Deutschland als Vorreiter:
Deutschland spielte eine Vorreiterrolle beim Start dieses positiven Feedbackprozesses durch Subventionen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) in einer Zeit, als die Technologien noch teurer waren.
Hemmnisse für weiteres exponentielles Wachstum:
Netzintegration:
Die unregelmässige Verfügbarkeit von Solar- und Windenergie erschwert die Integration ins Stromnetz. Erforderlich sind Netzausbau, flexible Verbraucher (Demand-Side Management) und Speichermöglichkeiten. Grosse Solarkraftwerke werden zunehmend mit Batteriespeichern ausgestattet.
Platzbedarf:
Erneuerbare Energien benötigen viel Fläche. Obwohl weltweit genügend Platz vorhanden ist, ist dieser nicht immer am richtigen Ort. Der Transport von Strom aus Wüstenregionen in urbane Zentren sowie die Akzeptanz in besiedelten Gebieten stellen Herausforderungen dar.
Rohstoffe:
Ein System aus Wind, Solar und Batterien erfordert grosse Mengen an Metallen (z.B. Kupfer, Aluminium, Lithium, Kobalt, seltene Erden). Engpässe und die ökologischen/sozialen Schäden des Abbaus könnten das Wachstum hemmen, wobei die Marktwirtschaft mit Knappheit umgehen kann und die Schäden des Klimawandels gravierender wären.
Die Energiewende in Deutschland – Stand, Herausforderungen und Chancen.
Kosten und Notwendigkeit:
Die Kosten der Energiewende sind schwer zu schätzen (von 500 Milliarden bis 1 Billion Euro), doch die Schäden des Klimawandels könnten noch viel höher sein. Die Energiewende ist entscheidend für den Klimaschutz und für die Transformation von Wärme, Verkehr und Wasserstoffwirtschaft.
Erfolge:
Deutschland hat bereits einen Anteil von 60% erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, wobei der Solarstrom mit 100 GW neu installierter Leistung im Jahr 2024 über den Zielen liegt.
Herausforderungen und Kritikpunkte:
Bürokratie:
Übermässige Bürokratie und langwierige Genehmigungsverfahren bei Netzbetreibern behindern den Ausbau und die Anschlüsse von Anlagen erheblich, mehr als fehlende Subventionen.
Mangelnde Planungssicherheit:
Inkonsistente politische Entscheidungen, wie plötzliche Änderungen bei Förderprämien (z.B. für E-Autos), untergraben das Vertrauen und die Investitionsbereitschaft von Bürgern und Unternehmen.
Fehlende Netzinfrastruktur:
Das grösste Problem sind fehlende Leitungen, um den Strom von Produktionsorten (Norden) zu Verbrauchszentren (Süden) zu transportieren.
Beispiel Südostlink:
Eine entscheidende Stromtrasse (für ca. 8 Millionen Haushalte) wurde 2013 beschlossen, der Bau begann jedoch erst 2023, und die vollständige Inbetriebnahme wird erst für 2030 erwartet (ursprünglich 2022). Verzögerungen entstanden durch Proteste und die teure Entscheidung, Freileitungen durch Erdkabel zu ersetzen.
Langfristiger Bedarf:
Zahlreiche weitere Projekte zum Netzausbau in Deutschland werden voraussichtlich erst bis 2045 abgeschlossen sein.
Debatte um Kosteneffizienz:
Einige Ökonomen fordern mehr Pragmatismus und Kosteneffizienz, wie die Platzierung erneuerbarer Energien an den günstigsten Standorten und die Bevorzugung von Freileitungen statt teurerer Erdkabel.
Status der Energiewende:
Die Einschätzungen zum Fortschritt der Energiewende variieren stark; während beim Strom bereits 60% erreicht sind, liegt der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energiekuchen nur bei etwa 21%. Experten betonen, dass ein schneller und gleichzeitiger Ausbau von Erzeugung, Speichern, Netzen und Digitalisierung unerlässlich ist, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.
Chancen und Lösungsansätze:
Innovationskraft:
Deutschland verfügt über exzellente Ingenieure, zahlreiche Patente und Spitzenforschung in Zukunftstechnologien. Diese intelligenten Technologien könnten zukünftige Exportgüter werden.
Speicherlösungen:
Startups entwickeln dezentrale Batteriespeichersysteme an Industriestandorten, um die Flexibilität im Stromnetz zu erhöhen und überschüssigen Strom zu speichern. Dieser dezentrale Ansatz kann schneller umgesetzt werden als der Bau einer komplett neuen Infrastruktur.
Integrierte Strategie:
Der Fokus lag zu lange auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien, während Netzausbau, Batteriespeicher und Digitalisierung vernachlässigt wurden. Ein integrierter Ansatz, der diese Elemente zusammenführt, ist entscheidend, um die Energiewende erfolgreich, sicher und bezahlbar zu gestalten und damit Klimaschutz und Wohlstand zu sichern.
Anmerkung "Schweiz":
Dieselben Themen gelten genauso für die Schweiz.
Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Energiespeicherung und Energiewende.
Neue und innovative Technologien zur Langzeitenergiespeicherung.
Die Suche nach effizienten und kostengünstigen Langzeitenergiespeichern ist entscheidend, um erneuerbare Energien flächendeckend nutzbar zu machen. Die "Sprint Challenge" der Bundesagentur für Sprunginnovation sucht nach Teams, die Strom mindestens 10 Stunden lang effizient und kostengünstig speichern können.
Innovative Ansätze der Energiespeicherung:
ISOchest – Wärmespeicherung in Salz:
Prinzip:
Das System basiert auf dem Wärmepumpenprinzip und speichert Wärme in Salz.
Aufladung:
Elektrischer Strom wird genutzt, um Wasserdampf zu erzeugen und auf 315°C zu überhitzen. Dieser Dampf wird mithilfe von Silikonöl-Flüssigkolben isotherm komprimiert. Die dabei freiwerdende Wärme wird in einem Wärmespeichermedium (Aluminium-Strukturen, die wie Schneeflocken aussehen) eingefangen, welches Salz (Natriumnitrat) enthält. Das Salz wird durch die Wärme flüssig und speichert Energie durch diesen Phasenwechsel.
Entladung:
Um Strom zu erzeugen, wird unter Druck stehendes Wasser in das System geleitet, wo es durch die gespeicherte Hitze des Salzes zu Wasserdampf erwärmt wird. Dieser Dampf nimmt weitere Wärme vom Salz auf, wodurch das Salz wieder fest wird. Der sich ausbreitende Wasserdampf drückt die Kolben herunter, und diese mechanische Kraft wird durch einen Generator zur Stromerzeugung genutzt.
Herausforderungen & Effizienz:
Eine wesentliche Herausforderung ist die geringe Wärmeleitfähigkeit des Salzes, die spezielle Strukturen zur Wärmeübertragung erforderlich macht. Die Forschungsgruppe erwartet einen Wirkungsgrad von etwa 70%.
Reverion – Wasserstofferzeugung und -rückverstromung:
Prinzip:
Das Team strebt den Bau eines völlig neuen Kraft- und Speicherwerks aus bereits existierenden Komponenten (hauptsächlich einer Brennstoffzelle) an, um aus Strom Wasserstoff zu produzieren und diesen dann wieder in Strom umzuwandeln.
Aufladung (Elektrolyse):
Strom wird in eine Brennstoffzelle geleitet, der Luft und ein gasförmiges Gemisch aus Wasser und Wasserstoff zugeführt werden. Das Gleichgewicht verschiebt sich, wodurch deutlich mehr Wasserstoff entsteht. Anschliessend kondensiert das Gemisch, trennt sich in flüssiges Wasser und reinen Wasserstoff.
Stromerzeugung (Rückverstromung):
Wasserstoff wird in einem geschlossenen Kreislauf mit einem zusätzlichen Wärmeträgermedium genutzt, das Abwärme aus der Brennstoffzelle effizient bei hohen Temperaturen (ca. 300°C) ableitet und teilweise wieder in Strom umwandelt.
Vorteile:
Der Wirkungsgrad der Stromerzeugung soll von typischerweise maximal 60% auf 80% erhöht werden, hauptsächlich durch die Integration von Abwärme. Die Umschaltzeit zwischen Stromerzeugung und Elektrolysephase wird auf etwa eine Minute reduziert (im Vergleich zu normalen 15 Minuten), was eine hohe Flexibilität für das Netz bietet.
Membranlose Redox-Flow-Batterien:
Grundproblem:
Herkömmliche Redox-Flow-Batterien verwenden oft teures und giftiges Vanadium, und die Membranen zwischen den Elektrolyten sind ebenfalls kostspielig.
Ziel der Innovation:
Verzicht auf Vanadium und die Membran, um Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern, wobei ein Kurzschluss verhindert werden muss (ähnlich der Trennung von Öl und Wasser).
Energieträger:
Verwendet organische Moleküle (derzeit geheim) in Wasser und einer ionischen Flüssigkeit.
Innovation:
Vergrösserung und physikalische Modulation der Elektrolytgrenzfläche (z.B. wellenförmig), um den Ionentransport zu verstärken und den Innenwiderstand zu senken.
Erwartete Vorteile:
20% höherer Wirkungsgrad und 30% geringere Kosten.
Projekt der Universität Manchester:
Ersetzt Vanadium durch Natriumchlorid (Salz), welches deutlich günstiger ist (ca. 40 €/Tonne vs. >7000 €/Tonne für Vanadium).
Speichergas & Elektrolyt: Verwendet Chlor oder Sauerstoff als Speichergas und Meerwasser sowie ein nicht mischbares organisches Lösungsmittel (eine Form von Öl) als Elektrolyt.
Mechanismus: Aktive Spezies werden durch Elektrolyse in die organische (Öl-)Phase extrahiert, wodurch keine Membran mehr benötigt wird.
Vorteil: Die Energiedichte bei Nutzung von Chlor ist mehr als doppelt so hoch wie bei Vanadium.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Quellenverzeichnis, August 2025:
Dominanz von Solar- und Windenergie Datenbasis, Studie Ember Energy
https://ember-energy.org/latest-insights/eu-wind-and-solar-overtake-fossil-fuels/
Dominanz von Solar- und Windenergie Datenbasis, Studie International Energy Agency
https://iea.blob.core.windows.net/assets/4e495603-7d8b-4f8b-8b60-896a5936a31d/IntegratingSolarandWind.pdf