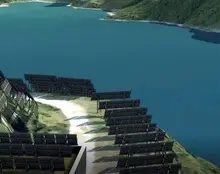Schweiz: 1,8 Milliarden CHF für 1 GW temporäre Reservekraftwerke (RKW) zu teuer im Vergleich mit Alternativen?
9.11.2025
COP30 Weltklimakonferenz Brasilien.
COP30 Weltklimakonferenz Brasilien, Bilanz 1,5-Grad-Ziel, Kipppunkte, Waldschutz, Elektrifizierung, CO2-Abscheidung und -Bepreisung. Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wurde faktisch verfehlt.
COP30 Weltklimakonferenz Brasilien.
Parallele zu Deutschland?
Gaskraftweke Deutschland und Strom-Versorgungssicherheit: Katherina Reiche auf dem Holzweg, nur 12 statt 20 Gigawatt? Parallelen zur Schweizer Kontroverse um neue Gaskraftwerke. Braucht es neue Gaskraftwerke in Deutschland?
Neue Gaskraftwerke in Deutschland?
29.9.2025
Das Fazit vorweggenommen.
Die Reservekraftwerke sind eine sehr teure Notfallversicherung, die nur dann wirklich vertretbar wäre, wenn die überlegenen, klimaneutralen und kostengünstigeren Alternativen (Hydroreserve, NSA-Pooling, Effizienz und Zubau der Erneuerbaren) nicht schnell genug realisiert werden könnten. Ihr Bau wird von vielen Experten als unnötiger Vorgriff angesehen, der Steuergelder und Konsumentenpreise unnötig belastet, anstatt die bestätigten, zielführenden Alternativen zu forcieren. Die geschätzten Kosten für fossile Reservekraftwerke (ca. 1,4 bis 1,8 Milliarden Franken) könnten wesentlich zielführender in Energieeffizienz und erneuerbare Stromproduktion investiert werden.
Weshalb hält der Bund trotzdem an dieser Strategie fest?
Inhaltsverzeichnins
Was ist die Idee hinter den neuen Reserve-Gaskraftwerken der Schweiz?
Technische Daten der Reservekraftwerke.
Weshalb wird der Bund für die Strategie der Reserve-Gaskraftwerke kritisiert?
Sind die Reservekraftwerke wirklich Co2 neutral?
Welche Alternativen gibt es zu temporären Reservekraftwerke (RKW)?
Weshalb werden diese alternativen Lösungen vom Bund nicht forciert?
Welchen Einfluss hat Albert Rösti als Bundesrat auf die Entscheidungsprozesse?
Haben die Standort-Kantone ein Mitspracherecht beim Entscheid für ein Reservekraftwerk?
Wer trägt die sehr hohen Kosten der Reservekraftwerke?
Fazit – sind Blog Reservekraftwerke überhaupt die richtige Lösung und vertretbar für die Schweiz?
Was ist die Idee hinter den neuen Reserve-Gaskraftwerken der Schweiz?
Die Frage nach der Notwendigkeit und dem Zweck fossiler Reservekraftwerke beschäftigt die Schweizer Energiepolitik intensiv, insbesondere seit der Gefahr einer Strommangellage im Winter 2022/23. Obwohl Umweltverbände und Experten Alternativen sehen, hat der Bundesrat den Bau neuer Reserveanlagen beschlossen. Was steckt hinter dieser umstrittenen Versicherungsstrategie und wofür sollen die neuen Kraftwerke tatsächlich eingesetzt werden?
Die offizielle Idee: Versorgungssicherheit als "Versicherung".
Die primäre Idee hinter den Reservekraftwerken (RKW) ist die Sicherstellung der Stromversorgung in Krisenszenarien. Die Schweiz ist besonders anfällig im Spätwinter, wenn die Speicherseen leer sind und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Importstrom (etwa durch Ausfälle französischer Kernkraftwerke oder Gasmangel in Europa) stark eingeschränkt ist.
Um diesen Worst-Case zu verhindern, stützt sich das Konzept, das ursprünglich auf Vorschläge der ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) zurückgeht, auf zwei Hauptpfeiler:
1. Schonung der Wasserkraftreserve:
Die RKW sollen nicht primär Leistung, sondern Energie liefern, um die Wasserkraftwerke zu entlasten. Sie kämen bereits mehrere Wochen vor einer absehbaren Mangellage zum Einsatz, um den Füllstand der Speicherseen hoch zu halten. Dadurch wäre im kritischen Spätwinter (Februar bis April) genügend Energie vorhanden, um Ausfälle von Grosskraftwerken oder fehlende Importe zu überbrücken.
2. Bereitstellung kurzfristiger Leistung auf Abruf:
Die RKW sollen nur im Notfall betrieben werden und stehen ausserhalb des regulären Strommarktes bereit. Die ElCom empfahl, ab 2030 mindestens 500 MW, ab 2035 sogar 700 bis 1'400 MW Reservekapazität vorzuhalten.
Als Reaktion auf die drohende Gaskrise 2022 beschloss der Bundesrat zunächst temporäre Massnahmen (gestützt auf die Winterreserveverordnung), wie das Reservekraftwerk Birr (250 MW), das nur bis Ende 2026 betriebsbereit sein sollte und dessen Gesamtkosten für die Laufzeit rund 470 Millionen Franken betrugen.
Die neuen Projekte und der CO₂-neutrale Anspruch.
Die Verträge für die temporären Kraftwerke (Birr, Cornaux, Monthey) laufen Ende Frühling 2026 aus. Als Ersatz hat das UVEK im Mai 2025 entschieden, fünf neuen Projekten den Zuschlag für die Zeit danach zu erteilen.
Diese neuen Anlagen sollen zwischen 2027 und 2030 betriebsbereit sein und eine Gesamtleistung von 583 Megawatt erbringen. Damit wird die Empfehlung der ElCom von mindestens 500 MW ab 2030 bereits erfüllt.
Ein zentraler Unterschied zu den älteren, fossilen Gaskraftwerksplänen ist der Anspruch, CO₂-neutrale Brennstoffe zu verwenden:
- Die Anlagen von Getec (in Eiken und Stein, AG) sollen mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden, das aus Lebensmittelfetten, Speiseresten und tierischen Abfällen gewonnen wird.
- Die Axpo plant ihr grösstes Projekt (291 MW) in Muttenz (BL) zunächst für den Betrieb mit Biodiesel/HVO und in einer zweiten Phase mit wasserstoffbasiertem E-Methanol zu konzipieren.
Kosten für Stromreserve.
Die Kosten für diese Stromreserve werden wie bisher über den Netznutzungstarif auf die Verbraucherinnen und Verbraucher überwälzt.
Die Kritik: Teuer, unnötig und rechtlich umstritten.
Die "Idee" der Reservekraftwerke stösst jedoch auf breiten Widerstand, da Kritiker die Notwendigkeit und die Kosten infrage stellen und Alternativen als effizienter und sicherer erachten.
1. Wirtschaftliche und ökologische Bedenken:
Hohe Kosten:
Die geschätzten Kosten für Reservekraftwerke in der Grösse von 1 GW liegen bei etwa 1,4 bis 1,88 Milliarden Franken. Der WWF befürchtet eine Fehlinvestition von bis zu einer Milliarde Franken, da diese Kosten letztendlich die Stromkonsumenten zahlen müssten.
Alternative Investitionen:
Kritiker argumentieren, dass diese Milliarde Franken wesentlich zielführender in den Ausbau der Energieeffizienz und der erneuerbaren Stromproduktion investiert werden könnte, da dies die Speicherseen in jedem Fall entlasten würde.
Obsolet durch Ausbau der Erneuerbaren:
Studien zeigen, dass eine Kombination aus einer verbindlichen Wasserkraftreserve (die gesetzlich vorgeschrieben und überwacht werden muss, um zusätzliche Winterstromproduktion nicht einfach am Markt zu verkaufen) sowie einem raschen Ausbau erneuerbarer Energien (gemäss den Zielen des Mantelerlasses) die beste Lösung darstellt und fossile Reservekraftwerke obsolet machen würde.
2. Strategische und rechtliche Mängel:
Zeitpunkt des Einsatzes:
Da Ausfälle von Grosskraftwerken (wie AKW) oft nicht vorhersehbar sind, könnten die RKW, die Wochen im Voraus in Betrieb genommen werden müssten, im schlimmsten Fall zu spät kommen, um eine Mangellage zu verhindern.
Vorrang der Alternativen:
Forderungen aus dem Parlament und von Experten sehen eine klare Kaskade vor: Die Stromreserve soll primär aus der Wasserkraftreserve und der verbrauchsseitigen Reserve (Lastreduktion bei Grossverbrauchern) gebildet werden, bevor auf die thermische Reserve zurückgegriffen wird. Auch die Nutzung bestehender Notstromaggregate (deren Reserveleistung bereits den prognostizierten Bedarf von 500 MW übersteigt) wird als günstigere Alternative gesehen.
Rechtliche Probleme:
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die ursprüngliche Betriebsbewilligung für das temporäre Kraftwerk Birr nicht gesetzeskonform war, da die drohende Mangellage für den Winter 2022/23 nicht ausreichend dokumentiert war. Trotz dieses Urteils hielt das UVEK fest, dass das Kraftwerk nicht zurückgebaut werden müsse, da sich das Urteil nur auf die Betriebsbewilligung, nicht jedoch auf die Baubewilligung bezog.
Zusammenfassend verfolgt der Bundesrat mit den neuen Reservekraftwerken die Idee einer kostspieligen, aber notwendigen Sicherheitsreserve gegen extreme Winterengpässe. Die Kritiker sehen darin jedoch einen unnötigen Vorgriff auf laufende Gesetzgebung und eine ineffiziente Mittelverwendung, die den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien und Effizienzmassnahmen verzögert.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis.
Technische Daten der Reservekraftwerke.
Basierend auf den unten aufgeführten Quellen lassen sich die technischen Daten der bestehenden temporären Reservekraftwerke (RKW) sowie der neu zugeschlagenen Reserveprojekte ab 2027 wie folgt auflisten:
I. Temporäre Reservekraftwerke
- (RKW) – Betrieb bis Frühling 2026
- Diese Anlagen wurden basierend auf Notrecht zur kurzfristigen Stärkung der Versorgungssicherheit während der Wintermonate bereitgestellt.
Merkmal |
Reservekraftwerk Birr (AG) |
RKW Cornaux (NE) & Monthey (VS) |
|
Gesamtleistung (temporäre Phase) |
250 Megawatt (MW) |
336 MW (Gesamtleistung aller drei bestehenden RKW [Birr, Cornaux, Monthey]) |
|
Anzahl/Typ der Einheiten |
8 modulare, mobile Gasturbinen-Generator-Einheiten |
|
|
Typenbezeichnung |
TM2500 von General Electric (GE) |
|
|
Leistung pro Einheit |
Jeweils etwas mehr als 30 MW |
|
|
Betriebsende/Rückbau |
Ende 2026 |
Verträge laufen Ende Frühling 2026 aus |
|
Mögliche Brennstoffe |
Erdgas oder Diesel (nach Norm EN590). Kann mit flüssigen Brennstoffen, synthetischen Brennstoffen oder Wasserstoff betrieben werden. |
|
|
Kosten (Gesamtlaufzeit) |
Rund 470 Millionen Franken |
|
|
Täglicher Brennstoffverbrauch (Max.) |
Erdgas: 1.8 Millionen m³ pro Tag. Diesel: 1’540 Tonnen pro Tag. |
|
|
NOx Emissionen (2 Wochen Betrieb) |
Erdgas: 33.5 t. Diesel: 63.3 t. |
|
|
CO₂ Emissionen (2 Wochen Betrieb) |
Erdgas: 50’750 t CO₂. Diesel: 67’000 t CO₂. |
|
|
Weitere Infrastruktur |
20 Meter hohe Lärmschutzwand. |
II. Neue Reservekraftwerke – Zuschlag ab 2027/2030.
Fünf Projekte mit einer Gesamtleistung von 583 Megawatt (MW) erhielten den Zuschlag, um die Versorgungssicherheit nach dem Auslaufen der temporären Verträge zu gewährleisten. Diese Gesamtleistung entspricht der minimalen Empfehlung der ElCom von 500 MW ab 2030.
|
Projekt-Name (Nr. in Quelle) |
Standort (Kanton) |
Betreiber |
Leistung (MW) |
Geplante Brennstoffe |
Betriebsbereitschaft |
|
1. Bestehendes RKW Monthey |
Monthey (VS) |
CIMO |
55 MW |
CO₂-neutral |
2027–2030 |
|
2. RKW Sisslerfeld 1 |
Eiken (AG) |
Getec |
13 MW |
Hydriertes Pflanzenöl (HVO) |
2027–2030 |
|
3. RKW Stein |
Stein (AG) |
Getec |
44 MW |
Hydriertes Pflanzenöl (HVO) |
2027–2030 |
|
4. RKW Sisslerfeld 2 |
Eiken (AG) |
Sidewinder |
180 MW |
CO₂-neutral |
2027–2030 |
|
5. RKW Auhafen |
Muttenz (BL) |
Axpo |
291 MW |
Zuerst Biodiesel/HVO, später wasserstoffbasiertes E-Methanol |
2027–2030 |
|
Gesamtleistung |
|
|
583 MW |
|
Anmerkung zu den Brennstoffen:
Die Getec-Anlagen sollen HVO (hydriertes Pflanzenöl), das aus Lebensmittelfetten, Speiseresten und tierischen Abfällen gewonnen wird, verwenden. Axpo plant für Muttenz zunächst HVO/Biodiesel und in einer zweiten Phase E-Methanol. Alle neuen Anlagen sollen mit CO₂-neutralem Brennstoff betrieben werden.
III. Historische und geplante Kapazitäten (ElCom/Studien).
- ElCom Empfehlung ab 2030: Mindestens 500 MW Reservekapazität.
- ElCom Empfehlung ab 2035: Zwischen 700 und 1'400 MW Reservekapazität.
- Maximale Planungsleistung: Frühere Pläne sahen die Beschaffung fossiler Kraftwerke mit einer maximalen Leistung von 1'000 MW vor.
Typische GuD-Kraftwerksleistung:
- (historisch): Grosse Gaskraftwerke (Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerke,
- GuD) in Europa erreichen typischerweise Leistungskategorien von 400 und 800 MWe.
- Die Schweizer Stromwirtschaft plante GuD-Kraftwerke in der Leistungskategorie von 400 MWe ohne weitgehende Abwärmenutzung.
Weshalb wird der Bund für die Strategie der Reserve-Gaskraftwerke kritisiert?
Der Bau und die Bereitstellung von Reservekraftwerken (RKW) – ursprünglich als kurzfristige Notlösung während der Energiekrise 2022/23 eingeführt und nun langfristig geplant – gehören zu den umstrittensten energiepolitischen Entscheidungen des Bundesrats. Trotz der Zusage für fünf neue RKW-Projekte ab 2027 mit einer Leistung von 583 MW, sehen Kritiker von Umweltverbänden über Wirtschaftsexperten bis hin zu Parlamentariern in dieser Strategie eine teure, unnötige und rechtlich fragwürdige Fehlinvestition.
Die zentralen Kritikpunkte an der Strategie der Reservekraftwerke sind:
1. Finanzielle Bedenken und Fehlinvestition.
Der häufigste und lautstärkste Kritikpunkt betrifft die hohen Kosten und die ineffiziente Mittelverwendung:
Belastung der Konsumenten:
Die Kosten für die Reservekraftwerke werden, wie bereits bei den temporären Anlagen, über den Netznutzungstarif auf alle Stromverbraucher überwälzt.
Massive Kosten:
Allein das temporäre RKW Birr (250 MW) kostete für eine begrenzte Laufzeit rund 470 Millionen Franken. Der WWF befürchtet, dass die geplanten neuen Reservekraftwerke eine "Fehlinvestition" von bis zu einer Milliarde Franken verursachen könnten. Die initialen Ausschreibungen für die neuen RKW ab 2026 mussten bereits wegen "zu hoher offerierter Kosten" abgebrochen werden.
Schlechtere Alternative:
Kritiker, darunter Experten der ZHAW, argumentieren, dass die dafür benötigten 1,4 Milliarden Franken wesentlich zielführender in den Ausbau der Energieeffizienz und die erneuerbare Stromproduktion investiert werden könnten. Der Ausbau erneuerbarer Energien und Effizienzmassnahmen würde die Speicherseen auf jeden Fall entlasten.
2. Strategische Notwendigkeit infrage gestellt (Obsolet durch Alternativen).
Experten und Umweltverbände halten neue, teure Gaskraftwerke für unnötig, da alternative Kapazitäten zur Sicherung der Winterversorgung bereits existieren oder besser ausgebaut werden sollten:
Existierende Reserven reichen aus:
Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) empfiehlt bis 2030 Stromreserven im Umfang von mindestens 500 MW. Die bestehende Infrastruktur, bestehend aus den drei temporären RKW (336 MW) und der nutzbar gemachten Leistung bestehender Notstromaggregate (NSA) (rund 300 MW), übersteigt diesen Bedarf bereits.
Unterschätzte Alternativen:
Die Strategie ignoriert die effizienteren und günstigeren Alternativen wie das Poolen von Notstromaggregaten (von Spitälern, Rechenzentren) und die Verbrauchsreserve (Lastreduktion bei Grossverbrauchern). Das Parlament hat diese Alternativen explizit gestärkt.
Fehlendes Tempo bei Erneuerbaren:
Ein konsequenter und schneller Ausbau der erneuerbaren Energien (insbesondere Photovoltaik und Windkraft) in Kombination mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Wasserkraftreserve würde die Notwendigkeit fossiler RKW gänzlich obsolet machen.
Zu späte Aktivierung:
Die fossilen Kraftwerke müssten Wochen vor einem unvorhersehbaren Ausfall (z. B. von AKW) eingesetzt werden, um die Hydroreserve zu schonen. Bei einem plötzlichen Störfall kämen sie zu spät, um eine Mangellage zu verhindern.
3. Rechtliche und politische Mängel.
Die Vorgehensweise des Bundesrats, insbesondere beim temporären RKW Birr, wurde scharf kritisiert und teilweise gerichtlich als fehlerhaft eingestuft:
Gerichtliche Rüge der Illegalität:
Das Bundesverwaltungsgericht urteilte, dass die Betriebsbewilligung für das temporäre RKW in Birr "nicht gesetzeskonform" war. Der Bundesrat hätte die zugrundeliegende Verordnung nicht erlassen dürfen, da die gesetzliche Voraussetzung einer "schweren Mangellage" im Winter 2022/23 nicht ausreichend belegt wurde.
Parlamentarische Missachtung:
Der Bundesrat wird beschuldigt, "respektlos gegenüber den parlamentarischen Beratungen" gehandelt zu haben, indem er den Bau neuer, teurer RKW beschloss, obwohl das Parlament seit langem über alternative, günstigere Lösungen für die "Stromreserve" beriet.
Verfassungswidrige Finanzierung:
Juristen haben kritisiert, dass die Finanzierung der Stromproduktion über das Netznutzungsentgelt verfassungswidrig sei, da diese Gebühr eigentlich den Stromnetzen vorbehalten ist.
4. Klima- und Umweltrisiken.
Obwohl die neuen RKW ab 2027 mit CO₂-neutralen Brennstoffen (HVO, E-Methanol) betrieben werden sollen, bleibt die Strategie aus Klima- und Umweltsicht umstritten:
Fossile Abhängigkeit:
Kritiker lehnen Gaskraftwerke grundsätzlich ab, da sie die Abhängigkeit von importiertem Erdgas erhöhen. Die Versorgungssicherheit mit Erdgas wird als tiefer eingeschätzt als die Versorgung über den freien Strommarkt.
Hohe Emissionen (temporär):
Das temporäre RKW Birr übertraf bei fossilem Betrieb die strengen Schweizer Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung (LRV) für Stickoxide (NOx) um das Zwei- bis Zweieinhalbfache. Zwar wurden Massnahmen ergriffen, aber die Genehmigung erfolgte nur durch eine temporäre Ausnahmeregelung.
Widerspruch zu Klimazielen:
Der Bau neuer Gaskraftwerksinfrastruktur, selbst als Reserve, steht im Widerspruch zum Ziel der Netto-Null-Gesellschaft bis 2050. Ein grosses Gaskraftwerk alleine könnte über 30 Jahre Betriebsdauer 5 bis 10 Prozent des gesamten verbleibenden Schweizer CO₂-Budgets bis 2050 ausstossen. Kritiker fordern, dass in einer verantwortungsvollen Klimapolitik "kein neues Gaskraftwerk Platz" hat.
Welches sind die technischen Probleme von temporären Reservekraftwerken (RKW) und wie werden sie gelöst?
Die technische Achillesferse der Notreserve – Probleme und Lösungen der temporären Reservekraftwerke.
Die temporären Reservekraftwerke (RKW) wie das Werk in Birr (AG) wurden 2022/23 im Schnellverfahren errichtet, um die Schweizer Stromversorgung in einem möglichen Engpass zu sichern. Dieser Notbetrieb, basierend auf mobilen Gasturbinen (TM2500), brachte jedoch massive technische und umweltrechtliche Herausforderungen mit sich.
Zentrale Probleme und die angewandten Lösungen, um den Betrieb der temporären RKW zu ermöglichen:
1. Lärmbelastung und fehlende Lärmschutzprüfungen
Problem:
Hohe Lärmemissionen aufgrund der Bauweise.
Lösung/Abmilderung:
Die acht mobilen Gasturbinen-Generator-Einheiten wurden im Freien auf dem Betriebsgelände von General Electric (GE) in Birr aufgestellt. Dies stellte eine grosse Lärmbelastung für die lokale Bevölkerung dar.
Problem:
Kurze Frist für die Realisierung.
Lösung/Abmilderung:
Aufgrund des extrem knappen Zeitplans für die Inbetriebnahme war die Durchführung umfassender Berechnungen und Untersuchungen der Schallemissionen, wie sie bei normalen Baubewilligungsverfahren üblich sind, nicht möglich.
Problem:
Anhaltende Lärmbelastung und Nachtruhe.
Lösung/Abmilderung:
Der Kanton Aargau forderte dringend die Einhaltung des gesetzlichen Zeitrahmens für den Beurteilungspegel gemäss Lärmschutzverordnung (LSV) zwischen 19:00 und 07:00 Uhr, da der Betrieb der mobilen Turbinen eine grosse Belastung darstellt.
2. Einhaltung der Luftreinhalteverordnung (LRV)
Problem:
Überschreitung der Emissionsgrenzwerte.
Lösung/Abmilderung:
Bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe (Erdgas oder Diesel) übersteigen die Stickoxid-Emissionen (NOx) die strengen Grenzwerte der Schweizer Luftreinhalteverordnung (LRV) um das Zwei- bis Zweieinhalbfache.
Problem:
Fehlende Abgasreinigung.
Lösung/Abmilderung:
Um die LRV-Grenzwerte einzuhalten, wäre eine Abgasreinigungsanlage (SCR-Katalysatoren) erforderlich, deren Installation aufgrund der langen Lieferzeiten (bis zu Mitte 2025 geschätzt) nicht rechtzeitig für den ersten Winter (2022/23) umgesetzt werden konnte.
Problem:
Temporäre Lockerungen gefordert.
Lösung/Abmilderung:
Der Kanton Aargau forderte, dass allfällige Lockerungen gegenüber der LRV im Bereich der Emissionsbegrenzungen nur für den Winter 2022/23 gewährt werden. Für die darauffolgenden Winter sei genügend Zeit für die Ertüchtigung der Anlagen (z. B. durch Nachrüstungen) vorhanden, um die LRV-Bestimmungen vollumfänglich einzuhalten.
3. Logistik und Brennstoffversorgung.
Problem:
Komplexe Brennstofflogistik (Diesel).
Lösung/Abmilderung:
Das temporäre RKW Birr muss wahlweise mit Erdgas oder Diesel (EN590) betrieben werden können. Bei einem dauernden Betrieb mit Diesel (1’540 Tonnen pro Tag) ist die Anlieferung des flüssigen Brennstoffs hochgradig logistikintensiv und erfordert täglich ein bis zwei Züge mit je 20 bis 22 Kesselwagen.
Problem:
Klimaneutralität und CO₂-Emissionen.
Lösung/Abmilderung:
Beim Betrieb mit fossilen Brennstoffen stösst das RKW Birr erhebliche Mengen CO₂ aus (z. B. 67’000 Tonnen CO₂ bei zweiwöchigem Dieselbetrieb).
4. Bauzeit und Netzanschluss
Problem:
Verzögerungen beim Netzanschluss.
Lösung/Abmilderung:
Das ursprünglich für den 15. Februar 2023 vorgesehene Fertigstellungsdatum konnte wegen des umfangreichen Aufwands für die Bereitstellung des Netzanschlusses an das Übertragungsnetz nicht eingehalten werden.
Problem:
Eingeschränkte Betriebsbereitschaft.
Lösung/Abmilderung:
Die Gasturbinen-Generator-Einheiten mussten umfangreichen
Inbetriebnahmetests unterzogen werden. Die ersten zwei Einheiten in Birr waren Ende Februar 2023 einsatzbereit, die restlichen sechs Ende März 2023.
5. Rechtliche Grundlage und Akzeptanz.
Problem:
Fehlende gesetzliche Grundlage für den Notbetrieb.
Lösung/Abmilderung:
Das Bundesverwaltungsgericht urteilte nachträglich, dass die
Betriebsbewilligung für das RKW Birr "nicht gesetzeskonform" war, da der Bundesrat die gesetzliche Voraussetzung einer "schweren Mangellage" im Winter 2022/23 nicht ausreichend belegt habe.
Problem:
Geringe Akzeptanz und Belastung der Standortgemeinden.
Lösung/Abmilderung:
Die temporären RKW wurden als
«Zumutung» für die Anwohner betrachtet, und die Notwendigkeit wurde von Experten und Umweltverbänden infrage gestellt.
Für die Zeit nach dem Auslaufen der temporären Verträge (Frühling 2026) wurden neue Projekte (ab 2027/2030) zugeschlagen. Für diese neuen Reservekraftwerke wird der Fokus auf CO₂-neutrale Brennstoffe gelegt (wie hydriertes Pflanzenöl (HVO) und E-Methanol), um zukünftige Umweltkonflikte und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu vermeiden. Allerdings muss für die Übergangszeit ab Winter 2026/27 noch eine temporäre Lösung gefunden werden, da die neuen Anlagen nicht nahtlos übernehmen können.
Sind die Reservekraftwerke wirklich Co2 neutral?
Die Reservekraftwerke (RKW) der Schweiz stehen im Fokus einer intensiven Debatte, insbesondere hinsichtlich ihrer Klimabilanz. Die Antwort auf die Frage, ob diese Anlagen CO₂-neutral sind, hängt stark davon ab, über welche Generation von Kraftwerken wir sprechen. Während die temporären Notfallkraftwerke auf fossilen Brennstoffen basierten, setzen die neuen, langfristig geplanten RKW ab 2027 konsequent auf CO₂-neutrale Energieträger.
1. Die Übergangslösung: Kompensation statt echter Neutralität (Bis 2026)
Die ersten temporären Reservekraftwerke, die ab dem Winter 2022/2023 in Birr (AG), Cornaux (NE) und Monthey (VS) eingesetzt wurden, waren nicht CO₂-neutral.
Brennstoffe:
Die acht mobilen Gasturbinen in Birr können mit Erdgas oder Diesel nach Norm EN590 betrieben werden. Beide sind fossile Energieträger.
CO₂-Emissionen:
Im Falle eines zweiwöchigen Betriebs stösst das RKW Birr erhebliche Mengen Treibhausgase aus: rund 50’750 Tonnen CO₂ mit Erdgas und rund 67’000 Tonnen CO₂ mit Diesel.
Kompensation:
Um die CO₂-Bilanz gesamthaft nicht zu belasten, muss das temporäre Reservekraftwerk Birr am Emissionshandelssystem (EHS) teilnehmen. Die Axpo Solutions AG, die für den Einsatz vertraglich verantwortlich ist, regelt unter anderem die Kosten für die Zertifizierung der CO₂-Emissionen gegenüber dem Bund.
Die Teilnahme am EHS bedeutet also, dass die Emissionen zwar anfallen, aber buchhalterisch durch den Kauf von Emissionsrechten kompensiert werden müssen. Gemäss dem WWF ist die Verbrennung von fossilem Gas jedoch grundsätzlich mit einer wirksamen Klimapolitik unvereinbar.
2. Die Zukunftsstrategie: Echte CO₂-Neutralität durch Brennstoffwechsel (Ab 2027).
Für die fünf neuen Reservekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 583 Megawatt (MW), die ab 2027 bis 2030 in Betrieb gehen sollen, hat der Bund die Verwendung CO₂-neutraler Brennstoffe zur Voraussetzung gemacht.
Der Status:
Alle fünf Anlagen, die den Zuschlag erhalten haben (Muttenz, Monthey, Sisslerfeld 1 & 2, Stein), werden im Falle einer Strommangellage mit CO₂-neutralem Brennstoff betrieben.
Hintergrund:
Der Ausbau sicher abrufbarer und klimaneutraler Stromerzeugung im Winter ist eine der vier Säulen zur Stärkung der Versorgungssicherheit. Die neuen Projekte sollen die Abhängigkeit von fossilem Gas beenden.
3. Technische Umsetzung: Welche CO₂-neutralen Brennstoffe kommen zum Einsatz?
Um die Klimaneutralität zu gewährleisten, setzen die Betreiber auf synthetische und biologische Brennstoffe, die aus Reststoffen oder erneuerbarem Strom gewonnen werden:
A. Hydriertes Pflanzenöl (HVO) und Biodiesel.
Die Anlagen der Getec in Eiken (Sisslerfeld 1) und Stein (AG) werden mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben. Auch die Axpo plant, ihre Anlage in Muttenz zunächst mit Biodiesel oder HVO zu nutzen.
Gewinnung:
Dieser Brennstoff wird aus Lebensmittelfetten, Speiseresten und tierischen Abfällen gewonnen.
Vorteil:
Da diese Rohstoffe bereits Teil eines natürlichen oder Abfallkreislaufs sind, wird ihre Verbrennung als CO₂-neutral betrachtet.
B. Wasserstoffbasiertes E-Methanol.
Die Axpo plant ihr grösstes Projekt in Muttenz so zu konzipieren, dass in einer zweiten Phase wasserstoffbasiertes E-Methanol zum Einsatz kommen soll.
Hintergrund:
Bei der Umstellung des Energiesystems spielen chemische Langzeitspeicher wie Wasserstoff und synthetische Brennstoffe (Power-to-X) eine sehr wichtige Rolle für die künftige Energieversorgung. Diese werden typischerweise mit überschüssigem Solarstrom (P2X) hergestellt, um Strom im Sommer zu speichern und in den Winter zu übertragen.
Obwohl der Betrieb von Gaskraftwerken generell abgelehnt wird, da sie hohe CO₂-Emissionen verursachen und grosse Mengen Erdgas (fossiles Gas) benötigen, wird die Nutzung von Gaskombikraftwerken als Übergangslösung betrachtet, solange sie mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden können. Die neuen Projekte in der Schweiz sollen diese fossile Abhängigkeit durch den direkten Einsatz CO₂-neutraler Alternativen vermeiden.
Welche Alternativen gibt es zu temporären Reservekraftwerke (RKW)?
Die Alternativen, die zur Sicherung der Versorgungssicherheit dienen, ohne neue fossile RKW bauen zu müssen, lassen sich in vier Hauptbereiche gliedern:
I. Nutzung und Optimierung bestehender Kapazitäten.
Die stärksten und unmittelbarsten Alternativen nutzen bereits existierende Infrastrukturen und sind in der Regel günstiger als der Neubau von RKW.
Wasserkraftreserve (Hydroreserve):
Die Wasserkraftreserve ist die primäre strategische Energiereserve. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und überwacht. Sie stellt sicher, dass Speicherkraftwerke Wasser gegen Entgelt zurückhalten und die benötigte Energiemenge im Notfall abrufbar ist. Die Bewirtschaftung der Speicherseen muss konsequent auf Versorgungssicherheit ausgelegt werden, um auch extreme Wettersituationen bis Ende Februar abfangen zu können.
Gepoolte Notstromaggregate (NSA):
Die Leistung bestehender Notstromaggregate, beispielsweise von Spitälern oder Rechenzentren, kann gebündelt und zentral gesteuert werden, um als Reservekapazität ausserhalb des Marktes bereitzustehen:
Die aktuell nutzbar gemachte Reserveleistung der Notstromaggregate beträgt rund 300 MW. Zusammen mit den temporären RKW (336 MW) übersteigt die bestehende Reserveinfrastruktur den von der ElCom prognostizierten Mindestbedarf von 500 MW bis 2030. Das potenzielle Gesamtpotenzial der grossen NSA wurde bereits 2019 auf rund 1200 MW geschätzt.
Verbrauchsseitige Reserve (Lastreduktion/Verbrauchsreserve):
Hierbei wird der Stromverbrauch von Grossverbrauchern im Notfall gegen Entschädigung reduziert. Das Parlament hat diese Option im Rahmen der Stromreservegesetzgebung erheblich gestärkt. Sie zählt neben der Wasserkraftreserve zur ersten Priorität in der Abrufkaskade.
II. Langfristige, systemische Lösungen.
Diese Massnahmen reduzieren den Energiebedarf im Winter generell oder erhöhen die heimische Produktion, wodurch die Speicherseen geschont und fossile RKW obsolet werden.
Rascher Ausbau der erneuerbaren Energien:
Ein beschleunigter Ausbau der inländischen erneuerbaren Stromproduktion (Säule 1 der Versorgungsstrategie des Bundes) wird als die beste Lösung für eine sichere Stromversorgung betrachtet.
Photovoltaik (PV):
Der Schwerpunkt liegt auf dem massiven Ausbau der PV, da sie kostengünstig und verbrauchsnah installiert werden kann. Ein rascher Zubau sorgt für zusätzliche Winterstromproduktion.
Windkraft:
Windkraftanlagen liefern vorwiegend im Winterhalbjahr Strom (zwei Drittel der Produktion) und sind aus Systemoptik optimal, um die Winterstromlücke zu verkleinern.
Energieeffizienz und Einsparungen:
Massnahmen zur Steigerung der Stromeffizienz und freiwillige Einsparungen (wie das vom Bundesrat angestrebte Ziel von 10 % Stromeinsparung im Winter) erzielen denselben Effekt wie der Einsatz fossiler Kraftwerke, da sie die Speicherseen schonen.
Experten weisen darauf hin, dass die Schweiz primär eine Effizienzlücke und nicht eine Stromlücke hat. Das Einsparpotenzial durch technische Massnahmen beträgt etwa 20 TWh oder ein Drittel des aktuellen Strombedarfs.
Stromabkommen mit der EU:
Eine verstärkte Einbindung der Schweiz in den internationalen Energiemarkt durch ein Stromabkommen mit der EU ist für eine langfristig wirtschaftliche und sichere Stromversorgung unerlässlich. Ein Abkommen würde die Versorgungssicherheit verbessern, die Notwendigkeit von RKW reduzieren und die Abhängigkeit von Importen absichern.
III. Speicher- und Flexibilitätslösungen.
Diese Lösungen helfen, die volatile Produktion aus Solar- und Windkraft auszugleichen und die Lücke im Winter zu überbrücken.
Power-to-X (P2X) und chemische Speicherung:
P2X-Anlagen können überschüssigen Solarstrom im Sommer mittels Elektrolyse in Wasserstoff (H₂) oder synthetische Brennstoffe (wie Methan oder E-Methanol) umwandeln. Diese chemischen Langzeitspeicher sind essenziell für den saisonalen Ausgleich und die Resilienz, da sie den Sommerüberschuss in den Winter übertragen. Die Nutzung von P2X-Kraftwerken wäre eine Alternative für den fossilfreien Betrieb der Reservekraftwerke.
Batteriespeicher:
Elektrische Speicher wie Pumpspeicherkraftwerke und Batterien sind geeignet für den Tag-Nacht-Ausgleich und zur Stabilisierung des Stromnetzes. Die Nutzung von Autobatterien (E-Autos) als kurzfristige Speichermedien mittels Bidirektionalem Laden (Vehicle to Grid) wird als wichtiger Baustein für das Stromsystem angesehen.
Blockheizkraftwerke (BHKW/WKK-Anlagen):
Diese Anlagen können flexibel Strom und Wärme produzieren und haben einen hohen Gesamtwirkungsgrad (85 % und mehr). Sie könnten potenziell mit erneuerbaren Gasen wie Biogas oder Wasserstoff betrieben werden.
IV. Strategische Kaskade (Priorisierung des Abrufs).
Eine Minderheit im Parlament fordert eine klare Kaskade für den Zubau und Abruf von Reserven, die die fossile thermische Reserve nur als Ultima Ratio vorsieht:
1. Erste Priorität: Wasserkraftreserve und Verbrauchsreserve.
2. Zweite Priorität: Aktivierung und Aggregation der bestehenden Notstromreserven.
3. Letzte Stufe (Ultima Ratio): Thermische Reserve (neue Gaskraftwerke), die nur dann in Betracht gezogen wird, wenn die anderen Massnahmen nicht ausreichen.
Weshalb werden diese alternativen Lösungen vom Bund nicht forciert?
Alternative Massnahmen wie der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien, massives Energiesparen und die Nutzung bestehender Notstromaggregate werden von Experten und Umweltorganisationen als "beste Lösung" für eine sichere Schweizer Stromversorgung angesehen – und vor allem als deutlich günstiger.
Dennoch hat der Bundesrat den Bau von fünf neuen Reservekraftwerken (RKW) mit 583 MW Leistung ab 2027 beschlossen, die in die Hunderte Millionen gehen. Die Kritiker werfen dem Bund vor, er setze auf die "teuerste und unnötigste Variante".
Warum forciert der Bund diese als überlegen geltenden Alternativen nicht konsequenter, sondern hält stattdessen an der kostspieligen Reservekraftwerks-Strategie fest?
1. Die offizielle Begründung: Sicherheit hat oberste Priorität.
Die primäre Motivation des Bundes, fossile (oder CO₂-neutrale) Reservekraftwerke zu beschaffen, liegt in der Risikominimierung und der kurzfristigen Sicherstellung der Energieversorgung in einem absoluten Krisenfall.
Abdeckung des Worst-Case-Szenarios:
Die grösste Bedrohung für die Schweizer Stromversorgung ist der gleichzeitige Ausfall aller Schweizer Atomkraftwerke im Spätwinter, wenn die Speicherseen leer sind und Importe stark eingeschränkt sind. Der Bund sieht die RKW als "Versicherung" gegen solche "kritischen Szenarien".
Schonung der Wasserkraftreserve:
Die RKW sollen primär dazu dienen, die Hydroreserve (Wasserkraftreserve) in den Speicherseen zu schonen, indem sie bereits Wochen vor einer absehbaren Mangellage Strom liefern. Nur so könnten die Seen im kritischen Spätwinter den nötigen Füllstand aufweisen, um Ausfälle zu überbrücken.
Zweifel an der Verlässlichkeit dezentraler Alternativen:
Obwohl die Nutzung gepoolter Notstromaggregate (NSA) von Experten favorisiert wird, argumentiert der Bundesrat, dass NSA alleine "technisch zu heterogen" und "nicht verlässlich genug" seien, um eine stabile Versorgung über mehr als wenige Tage hinweg zu gewährleisten. Das Ziel des Bundes ist es, jedes Risiko auszuschalten.
2. Politische Ungeduld und Missachtung des Parlaments.
Ein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass der Bundesrat mit dem Bau der RKW "vorgeprescht" ist, ohne die Alternativen im Gesetz ausreichend zu berücksichtigen oder die parlamentarischen Prozesse abzuwarten.
Ignorieren der parlamentarischen Kaskade:
Das Parlament berät seit Längerem über die "Stromreserve" und hat klargestellt, dass es den Bau neuer Gaskraftwerke als "Ultima Ratio" betrachtet, nachdem alle anderen Optionen (Wasserkraftreserve, Verbrauchsreserve, NSA) ausgeschöpft sind. Der Bundesrat hat jedoch den Bau von RKW kurz vor der Schlussabstimmung zur Stromreserve beschlossen.
Geringschätzung innovativer Lösungen:
Das sture Festhalten des Bundesrats an der RKW-Technologie zeige, dass die Landesregierung "wenig Vertrauen in innovative Ansätze" der Energiepolitik hat, wie sie das Parlament und Cleantech-Vertreter fördern.
Beschleunigte Bauzeit als Argument:
Die Strategie wurde im Zuge der Energiekrise 2022 unter Notrecht eingeleitet. Ein Gaskraftwerk (wie das temporäre in Birr) kann in einer Notsituation innerhalb weniger Monate bewilligt und gebaut werden. Diese Geschwindigkeit ist bei komplexen, dezentralen Effizienzmassnahmen oder dem langfristigen Ausbau der Erneuerbaren, der oft durch Widerstände blockiert wird, schwieriger zu erreichen.
3. Fehlende langfristige Planung und finanzielle Fehlanreize.
Obwohl Studien belegen, dass der Ausbau der Erneuerbaren ökonomisch und ökologisch die besseren Ergebnisse liefert, konzentriert sich der Bund auf RKW, was zu Kritik an der Mittelverwendung führt.
Hohe Kostenbelastung der Konsumenten:
Kritiker befürchten, dass die Kosten für die neuen RKW von geschätzten 1,4 Milliarden Franken eine "Fehlinvestition" darstellen. Diese Kosten werden letztlich über den Netznutzungstarif auf die Verbraucher überwälzt.
Vernachlässigung der Effizienzpolitik:
Trotzdem das Einsparpotenzial durch Effizienzmassnahmen massiv ist (etwa 20 TWh oder ein Drittel des Bedarfs) und die Schweiz eine "Effizienzlücke" statt einer "Stromlücke" hat, besteht laut Kritikern seit Jahren "kein politischer Wille", das Problem des ausufernden Verbrauchs ernsthaft anzugehen.
Fokus auf Importabhängigkeit:
Während Alternativen wie Power-to-X und ein schnelles Stromabkommen mit der EU als essenziell für die langfristige Versorgungssicherheit und Kostenreduktion betrachtet werden, geht die RKW-Strategie davon aus, dass die Versorgungssicherheit mit Erdgas (obwohl dieser zu 100 % importiert wird) gesichert werden kann, während der freie Strommarkt im Winter versagen könnte.
Der Bundesrat hat die RKW-Strategie primär aus Gründen der Risikoaversion und der kurzfristigen Sicherstellung der Netzstabilität verfolgt, selbst wenn dies die teuerste und umweltschädlichste Option darstellt. Kritiker sehen darin jedoch einen unnötigen Vorgriff auf laufende Gesetzesrevisionen und einen Mangel an Vertrauen in die dezentralen, marktbasierten und langfristig effektiveren Lösungen.
Welchen Einfluss hat Albert Rösti als Bundesrat auf die Entscheidungsprozesse?
Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), ist die Schlüsselfigur in der aktuellen Strategie zur Sicherstellung der Schweizer Stromversorgung mittels thermischer Reservekraftwerke (RKW). Sein Einfluss manifestiert sich in einem entschiedenen Festhalten an der Reservekraftwerks-Strategie, das er mit dem Gebot der maximalen Versorgungssicherheit begründet, auch wenn er damit teils massive Kritik von Parlament, Experten und Umweltverbänden auf sich zieht.
1. Die Entscheidung zur Schaffung langfristiger Reservekapazitäten.
Röstis Einfluss zeigt sich vor allem in der Konsequenz, mit der er die Pläne für die Reservekraftwerke über die temporäre Notlösung hinaus vorantreibt.
Sicherheitsmaxime und Begründung:
Rösti verfolgt das Ziel, "auf Nummer sicher zu gehen". Er begründet die Notwendigkeit der Reservekraftwerke damit, dass diese bei kritischen Szenarien – wie einer Gasmangellage, einem sehr kalten Winter, Importbeschränkungen durch Nachbarstaaten oder unerwarteten Revisionen von Kernkraftwerken – unverzichtbar sind, um einen Strommangel zu verhindern.
Genehmigung neuer RKW:
Trotz Bedenken und Kritik hat das UVEK im Mai 2025 entschieden, fünf neuen Projekten mit einer Gesamtleistung von 583 Megawatt (MW) den Zuschlag zu erteilen. Damit wird die Empfehlung der ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) von mindestens 500 MW Reservekapazität ab 2030 erfüllt. Die neuen Anlagen sollen zwischen 2027 und 2030 betriebsbereit sein.
2. Ablehnung von Alternativen und Kritik an dezentralen Lösungen.
Ein zentraler Punkt von Röstis Einfluss ist seine Bewertung und Ablehnung von Alternativen, die von Experten als kostengünstiger und effizienter angesehen werden.
Heterogenität der Notstromaggregate:
Auf Nachfrage verteidigte Bundesrat Rösti die RKW-Strategie, indem er feststellte: "Notstromaggregate alleine [seien] technisch zu heterogen 'und nicht verlässlich genug, um über mehr als wenige Tage hinweg eine stabile Versorgung zu gewährleisten.'".
Abstriche an der Effizienz:
Kritiker werfen dem Bundesrat, dessen Departement Rösti vorsteht, vor, er riskiere eine "Fehlinvestition", da eine ausgewogene Abstimmung der verschiedenen Reservearten ungenügend stattgefunden habe. Experten der ZHAW sehen in den RKW die "teuerste und unnötigste Variante", da die dafür benötigten 1,4 Milliarden Franken zielführender in den Ausbau von Energieeffizienz und erneuerbare Stromproduktion investiert werden könnten.
3. Vorgehen gegen parlamentarischen und juristischen Widerstand.
Röstis Rolle ist auch durch das Führen von Entscheidungsprozessen gekennzeichnet, die parallel zu laufenden parlamentarischen Beratungen stattfanden und juristisch angefochten wurden.
Vorgehen gegen den Parlamentarischen Willen (Ultima Ratio):
Der Bundesrat wird kritisiert, mit der Schaffung neuer RKW "vorgeprescht" zu sein. Dies sei "respektlos gegenüber den parlamentarischen Beratungen", da das Parlament den Bau neuer Gaskraftwerke als "Ultima Ratio" betrachtet, nachdem alle anderen Optionen (wie gepoolte Notstromaggregate und Verbrauchsreserven) ausgeschöpft sind. Das Parlament berät seit Längerem über das neue Stromreservegesetz, das diese Alternativen priorisiert.
Rechtliche Kontroverse:
Juristen kritisierten Röstis Pläne, da sie das Vorgehen als "verfassungswidrig" bewerteten. Die Kritik betraf insbesondere die Finanzierung der Kraftwerke über das sogenannte Netznutzungsentgelt (Netznutzungsgebühr), welches eigentlich für die Stromnetze reserviert sei. Das zuständige Bundesamt für Energie (BFE) wies diese Kritik zurück und argumentierte, die RKW dienten im Notfall der Stabilisierung des Stromnetzes und dürften daher über die Gebühr finanziert werden.
Faktenschaffung ohne Rechtsgrundlage:
Die Klimastreikbewegung kritisierte Rösti scharf, dass er "klimazerstörende Fakten" schaffe, obwohl das Stromversorgungsgesetz (Stromreserve) noch in der Vernehmlassung war und somit "aktuell [k]eine gesetzliche Grundlage" für die Ausschreibung der Reservekraftwerke bestand.
4. Umgang mit der Kostenproblematik.
Rösti war auch in die Abwicklung der Ausschreibungen involviert, bei denen finanzielle Probleme auftraten:
Abbruch der Ausschreibung:
Die erste Ausschreibung für neue Reservekraftwerke musste wegen "zu hoher offerierter Kosten" abgebrochen werden.
Direktverhandlungen:
Das BFE, das Rösti untersteht, reagierte darauf mit der Ankündigung, Direktverhandlungen mit den Anbietern führen zu wollen, um "genauer auf einzelne Projekte einzugehen". Dies zielte darauf ab, die Kosten zu senken und andere Kriterien besser zu erfüllen.
Hohe Kostenbelastung:
Unabhängig von den Verhandlungen werden die Kosten für die Reservekraftwerke wie bisher über den Netznutzungstarif auf die Verbraucherinnen und Verbraucher überwälzt.
Haben die Standort-Kantone ein Mitspracherecht beim Entscheid für ein Reservekraftwerk?
Die Entscheidung des Bundes, Reservekraftwerke (RKW) zur Sicherung der Stromversorgung im Winter zu bauen und zu betreiben, ist Chefsache des Bundesrates und des UVEK (Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation). Obwohl die Kantone und Gemeinden die unmittelbaren Auswirkungen von Lärm, Luftverschmutzung und Logistik tragen, ist ihr direktes politisches Mitspracherecht bei der grundlegenden Frage des Ob und Wo dieser nationalen Notreserve stark eingeschränkt. Ihr Einfluss manifestiert sich vielmehr in juristischen Einsprachen, finanziellen Abgeltungen und Forderungen nach strengen Auflagen.
1. Die temporäre Notlösung: Bewilligung unter Notrecht.
Beim ersten temporären Reservekraftwerk in Birr (AG) zeigte sich, dass der Bund in dringenden Notlagen die kantonalen und kommunalen Mitspracheprozesse drastisch umgehen kann.
Umgehung ordentlicher Verfahren:
Um die Anlage in Birr rechtzeitig für den Winter 2022/23 betriebsbereit zu machen, erliess der Bundesrat eine spezielle Verordnung gestützt auf das Landesversorgungsgesetz. Dieses spezielle bundesrechtliche Bewilligungsverfahren sah keine öffentliche Auflage des Baubewilligungsgesuchs vor, da die zeitliche Dringlichkeit dies verunmöglichte.
Information statt Konsultation:
Der Kanton Aargau und die Gemeinde Birr wurden in diesem Notfallverfahren lediglich informiert, bevor der Vertrag zwischen dem Bund und General Electric (GE) abgeschlossen wurde.
2. Einfluss durch Forderungen und Entschädigungen.
Obwohl die Kantone den Bau nicht verhindern konnten, übten sie Druck aus und sicherten sich Kompensationen.
Umweltauflagen und Schutz der Bevölkerung:
Der Kanton Aargau trug die Massnahmen des Bundes zwar mit, stellte aber klare Forderungen: Die Anlage müsse so gebaut und betrieben werden, dass möglichst wenig Immissionen (Lärm, Luft) entstehen und der Schutz von Bevölkerung und Umwelt jederzeit gewährleistet ist. Der Kanton forderte zudem, dass Lockerungen der Grenzwerte (wie bei der Luftreinhalteverordnung, LRV) nur für den ersten Winter gewährt werden und die Betreiber für die darauffolgenden Winter Ertüchtigungsmassnahmen ergreifen müssen.
Priorisierung der Alternativen:
Der Aargau forderte, dass das RKW Birr nur als "Notlösung" gilt und zuerst alle anderen Optionen ausgeschöpft werden (Wasserkraftreserve bzw. Notstromaggregate), bevor die immissionsträchtigen, im Freien aufgestellten Turbinen zum Einsatz kommen.
Finanzielle Abgeltung:
Die Standortgemeinde Birr (AG) konnte gestützt auf das kantonale Energiegesetz eine Inkonvenienzentschädigung aushandeln. Die Gemeinde Birr AG erhält über vier Jahre eine Abgeltung von bis zu 4,3 Millionen Franken. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat auch mit der Gemeinde Lupfig Verhandlungen über eine Entschädigung geführt.
Tolerierung der nationalen Verantwortung:
Auch in der Debatte um den möglichen Standort Perlen (LU) wurde deutlich, dass der Kanton Luzern bereit war, die Verantwortung mitzutragen, sofern das RKW als reine, restriktive "Versicherungslösung" toleriert wird, selbst wenn dies eine "Zumutung" für die Anwohner bedeutet.
3. Juristische Beschränkungen der Bundesgewalt.
Das stärkste Mitspracherecht liegt auf der juristischen Ebene.
Anfechtung der Bewilligung:
Gegen die Bewilligung für das RKW Birr wurden Einsprachen erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht gab der Beschwerde einer Anwohnerin gegen die Betriebsbewilligung nachträglich Recht. Das Gericht stellte fest, dass die Bewilligung "nicht gesetzeskonform" war, da die gesetzliche Voraussetzung einer "schweren Mangellage" im Winter 2022/23 nicht ausreichend belegt war.
Auswirkungen des Urteils:
Obwohl das Urteil feststellte, dass die Betriebsbewilligung nicht rechtens war, bezog sich die Entscheidung nicht auf die Baubewilligung. Das UVEK entschied, dass das RKW Birr deshalb nicht zurückgebaut werden muss.
4. Der neue Weg: Ordentliche Verfahren ab 2027.
Die fünf neuen Reservekraftwerk-Projekte ab 2027 in den Kantonen Wallis, Aargau und Basel-Landschaft sollen im Rahmen ordentlicher Bewilligungsverfahren geplant werden.
Einsprachen möglich, politischer Veto fehlt:
Am Beispiel des grössten geplanten RKW in Muttenz (BL) wird klargestellt, dass die Planung im Rahmen "ordentlicher Bewilligungsverfahren" erfolgt. Dies bedeutet, dass Einsprachen (objections) möglich sind, aber kein politisches Mittel zur Gegenwehr (wie eine Abstimmung) vorgesehen ist.
Lokale Akzeptanz:
In den Standortgemeinden der neuen RKW, wie Eiken (AG), wurde das Vorhaben grösstenteils begrüsst. Der Gemeindepräsident von Stein (AG) betonte, dass normale Verfahren wie die Umweltverträglichkeitsprüfung und das Baugesuch durchlaufen werden müssen und Lärmschutzregeln einzuhalten sind.
Anpassung von Vorschriften:
Die Gemeinde Eiken (AG) muss für ihre zwei RKW-Projekte die Bau- und Nutzungsordnung anpassen.
Verlust des temporären Standortes:
Es ist bemerkenswert, dass am bisherigen Standort des temporären Notkraftwerks Birr (AG) kein neues RKW mehr geplant ist, was der Aargauer Regierungsrat zur Kenntnis nahm.
Die Kantone und Gemeinden in der Schweiz haben zwar keine politische Veto-Macht gegen die Strategie der nationalen Stromreserve, aber starke Rechte im Bereich Umweltschutz, Entschädigung und juristischer Einsprache besitzen. Diese Rechte sind im ordentlichen Verfahren (wie bei den neuen RKW ab 2027) durch die Möglichkeit der Einsprache gesichert, während sie im Notfall (wie in Birr) durch das UVEK per Verordnung befristet ausgesetzt oder gelockert werden können.
Wer trägt die sehr hohen Kosten der Reservekraftwerke?
Der Bau und die Bereitstellung von Reservekraftwerken (RKW) – sei es die temporäre Notlösung in Birr oder die fünf neuen Projekte, die ab 2027/2030 in Betrieb gehen sollen – sind ein milliardenschweres Vorhaben, das der Bund zur Sicherung der Winterstromversorgung verfolgt. Obwohl die Energieminister Albert Rösti die Notwendigkeit dieser „Versicherung“ betonen, ist die Strategie hoch umstritten. Kritiker sehen darin eine unnötige Geldverschwendung und eine mögliche Fehlinvestition von bis zu einer Milliarde Franken.
Doch wer bezahlt diese hohen Kosten, die entstehen, damit die Kraftwerke nur im Notfall bereitstehen müssen?
Der direkte Zahler: Die Schweizer Stromkonsumenten.
Die Regelung ist klar und betrifft jeden Strombezieher in der Schweiz: Die sehr hohen Kosten für die gesamte Stromreserve werden auf die Endverbraucher überwälzt.
1. Finanzierung über den Netznutzungstarif: Die Kosten für die Reservekraftwerke (sowohl die temporären als auch die neuen Projekte) werden den Verbraucherinnen und Verbrauchern über den Netznutzungstarif verrechnet.
2. Verrechnung proportional zum Verbrauch: Die Verteilung der Kosten erfolgt proportional zum individuellen Stromverbrauch der Konsumenten.
3. Gesetzliche Verankerung: Die Kosten für sämtliche Winterreserven (einschliesslich der Wasserkraftreserve, der Notstromgruppen und der RKW) werden gemäss Verordnung über einen neuen Zuschlag auf dem Netztarif von Swissgrid finanziert.
4. Anrechenbare Kosten: Als anrechenbare Betriebskosten des Übertragungsnetzes gelten unter anderem die mit der Bildung und Bewirtschaftung der Stromreserve verbundenen Kosten. Dazu zählen insbesondere Pauschalabgeltungen und Entgelte für die Teilnahme, Abrufentschädigungen, die Rückerstattung der Kosten für den Rückbau von Reservekraftwerken und die Kosten für die Gewährleistung der Brenn- und Treibstoffversorgung.
Die Höhe der Rechnung: Hunderte Millionen Franken.
Sowohl die bereits realisierten temporären Lösungen als auch die geplanten langfristigen Projekte verursachen hohe Kosten, die von den Konsumenten getragen werden müssen:
- Kosten der temporären RKW: Die Gesamtkosten für die gesamte Laufzeit des temporären Reservekraftwerks in Birr (250 MW), das bis Ende 2026 betrieben wird, beliefen sich auf rund 470 Millionen Franken.
- Kosten der neuen RKW: Die fünf neuen RKW-Projekte (583 MW Gesamtleistung) sollen den Bund einen "dreistelligen Millionenbetrag" kosten. Der WWF befürchtet sogar eine "Fehlinvestition" von bis zu einer Milliarde Franken.
- Abgebrochene Ausschreibung: Eine frühere Ausschreibung für neue RKW musste das Bundesamt für Energie (BFE) aufgrund von "zu hoher offerierter Kosten" abbrechen. Die Kosten für die Anlagen werden erst nach dem Abschluss der Vertragsverhandlungen bekannt sein.
- Alternative Kostenbetrachtung: Experten schätzen, dass der Bau fossiler Reservekraftwerke mit einer Leistung von 1 GW (was in der ursprünglichen Planung stand) linear hochskaliert etwa 1,88 Milliarden Franken kosten würde. Andere Studien nennen Kosten von etwa 1,4 Milliarden Franken für fossile Reservekraftwerke.
Versteckte Kosten und Entschädigungen.
Neben den direkten Kosten für Bau, Betrieb und Bereitstellung der Reserve fallen weitere Kosten an, die letztlich der Bund, und damit die Allgemeinheit, trägt:
- Entschädigung der Standortgemeinden: Die Standortgemeinden der temporären Kraftwerke, wie Birr (AG), erhalten vom Bund (über den Vertragspartner) eine Inkonvenienzentschädigung für die Duldung der Anlage und die damit verbundenen Lasten (Lärm und Luftbelastung). Die Gemeinde Birr erhält über vier Jahre bis zu 4,3 Millionen Franken.
- CO₂-Kompensation: Für das RKW Birr ist vertraglich geregelt, dass es am Emissionshandelssystem (EHS) teilnehmen muss, damit die CO₂-Bilanz gesamthaft nicht belastet wird. Die Kosten für die Zertifizierung der CO₂-Emissionen sind im Dienstleistungsvertrag mit Axpo geregelt und werden dem Bund in Rechnung gestellt.
- Logistische Kosten: Kosten für die Beschaffung und den Transport von Brennstoffen (Öl und Gas), Lagerkapazitäten und Versicherungen sind ebenfalls Drittkosten, die vom Bund getragen werden.
Die Kontroverse: Geldverschwendung oder notwendige Versicherung?
Kritiker argumentieren, dass die 1,4 Milliarden Franken für die fossilen Reservekraftwerke wesentlich zielführender in den Ausbau der Energieeffizienz und die erneuerbare Stromproduktion investiert werden könnten. Sie betonen, dass diese Investitionen in erneuerbare Energien und Effizienz die Speicherseen auf jeden Fall entlasten würden, wohingegen fossile Kraftwerke im Normalbetrieb keine finanziellen Einnahmen generieren. Dem hält der Bundesrat entgegen, dass die Kosten einer Strommangellage um ein Vielfaches höher wären als die Ausgaben für die RKW-Reserve, was die Strategie zur Absicherung kritischer Szenarien notwendig macht.
Macht sich die Schweiz mit Gas-Reservekraftwerken abhängig von ausländischem Gas? Von russischem Gas oder von amerikanischen Fracking-Gas? Und für wie lange?
Die Beschaffung von Reservekraftwerken (RKW) durch den Bund, insbesondere die Diskussion um die Nutzung von Gas und Diesel, wirft zentrale Fragen zur nationalen Energieunabhängigkeit auf. Die Schweiz, die fast keine eigenen fossilen Vorkommen besitzt, begibt sich mit Gaskraftwerken unweigerlich in eine heikle Importabhängigkeit.
Abhängigkeiten, die durch die RKW-Strategie entstehen, und wie lange diese voraussichtlich andauern.
1. Die fundamentale Importabhängigkeit der Schweiz.
Die Schweiz importiert derzeit 100 Prozent ihres Erdgasbedarfs. Der Bau von Gaskraftwerken, selbst als Reserve, verschärft diese Auslandsabhängigkeit im Energiesektor entscheidend.
Kritiker warnen seit Langem, dass die Versorgungssicherheit mit Erdgas tiefer liegt als jene auf dem freien Strommarkt. Zudem konzentrieren sich die weltweiten Erdgasreserven auf sehr wenige, teils politisch instabile Regionen (hauptsächlich Russland, Iran und Katar), was die Schweiz von sehr wenigen grossen Gaslieferanten abhängig macht. Politische Krisen, insbesondere solche, die Russland betreffen, können die Gaspreise stark in die Höhe schnellen lassen.
Würde ein GuD-Kraftwerk der historisch geplanten Grösse von 400 Megawatt (MWe) gebaut, würde dies den Gasverbrauch der Schweiz um 10 Prozent ansteigen lassen.
2. Die Abhängigkeit im Kontext der Ukraine-Krise (Russisches Gas).
Die Notwendigkeit, überhaupt Reservekraftwerke zu errichten, entstand direkt aus einer geo-politischen Abhängigkeit und der darauffolgenden Krise:
Ursache der Mangellage:
Das erhöhte Risiko einer Gas- und/oder Strommangellage im Winter 2022/23 war eine direkte Folge des Krieges in der Ukraine und des damit verbundenen Ausfalls der russischen Gasimporte nach Europa.
Vorsorge für die Folgejahre:
Die Bundesbehörden mussten davon ausgehen, dass die Versorgungssituation in den folgenden Wintern noch herausfordernder sein würde, da das russische Gas zur Wiederbefüllung der Gasspeicher bis Herbst 2023 von Anfang an wegfiel
Die Reservekraftwerke dienen primär dazu, die Abhängigkeit von Importen in kritischen Wintermonaten zu reduzieren. Paradoxerweise basieren die temporären RKW wie Birr (bis Ende 2026) jedoch selbst auf Erdgas (oder Diesel). Das Erdgas wird dabei aus dem Pipeline-Netzwerk der Erdgas Ostschweiz AG bezogen.
3. Die Abhängigkeit von amerikanischem Fracking-Gas (LNG).
Seit dem Ausfall russischer Gaslieferungen wird Europa zunehmend von anderen Quellen abhängig, darunter Flüssiggas (LNG, Liquid Natural Gas), das zu grösseren Teilen aus den USA importiert wird.
Wachsende Abhängigkeit:
Die USA decken rund ein Siebtel des europäischen Gasbedarfs über Flüssiggastransporte, mit einer steigenden Tendenz.
Politisches Erpressungspotenzial:
Experten warnen, dass diese wachsende Abhängigkeit von den USA problematisch sei. Ein US-Präsident könnte die Gasimporte einstellen und Europa erpressen, was zu dramatisch steigenden Gaspreisen führen würde.
Umweltbilanz des Fracking-Gases:
Das in den USA häufig via Fracking gewonnene Erdgas wird in der Kritik als "mega Klimakiller" bezeichnet. Beim Fracking entweichen grosse Mengen an Methan (ein starkes Treibhausgas) unverbrannt in die Atmosphäre. Eine Analyse kommt gar zum Schluss, dass es für das Klima besser wäre, Kohle zu verbrennen als LNG/Flüssiggas aus den USA. Obwohl die Schweiz in ihrer Klimabilanz nur das CO₂ zählt, das direkt bei der Verbrennung entsteht, ist dies für das Weltklima irrelevant.
4. Dauer der Abhängigkeit und Wandel der Brennstoffe.
Die Frage, für wie lange die Schweiz diese Abhängigkeit aufrechterhält, hängt von der Art der RKW ab (temporär vs. neu):
Kraftwerkstyp: Temporäre RKW (Birr, Cornaux, Monthey)
Laufzeit: Bis Ende Frühling 2026
Brennstoffbasis: Erdgas (Pipeline) oder Diesel (EN590)
Abhängigkeit: Direkte Abhängigkeit von fossilen Importen (Gas/Öl)
Kraftwerkstyp: Neue RKW (5 Projekte, 583 MW)
Laufzeit: Betriebsbereit zwischen 2027 und 2030
Brennstoffbasis: CO₂-neutrale Brennstoffe
Abhängigkeit: Ziel: Reduktion der fossilen Abhängigkeit
Der Bund setzt bei den fünf neuen Reservekraftwerken (ab 2027/2030) darauf, die Abhängigkeit von fossilem Erdgas zu beenden, indem die Anlagen ausschliesslich mit CO₂-neutralen Brennstoffen betrieben werden sollen.
Ein Teil der Anlagen plant, hydriertes Pflanzenöl (HVO) zu nutzen, das aus Lebensmittelresten, Speiseresten und tierischen Abfällen gewonnen wird.
Das grösste neue Projekt (Axpo in Muttenz) will zunächst Biodiesel/HVO und in einer zweiten Phase wasserstoffbasiertes E-Methanol verwenden.
Obwohl Gaskombikraftwerke theoretisch auch mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden könnten, ist die Produktion synthetischer Brennstoffe in der Schweiz aus Kosten- und Platzgründen stark limitiert und erfordert ihrerseits den Import grosser Mengen an erneuerbaren synthetischen Energieträgern (z. B. Wasserstoff) aus dem Ausland. Allerdings wird argumentiert, dass die Importabhängigkeit bei einer CO₂-armen Versorgung um etwa die Hälfte bis zwei Drittel abnimmt und auf mehr Länder verteilt ist als heute.
Somit besteht die direkte Abhängigkeit von fossilem Gas (wie Erdgas/Diesel) für die offizielle Notreserve nur noch für die temporäre Übergangsphase bis 2026/2027. Die langfristig geplanten Reservekraftwerke sollen die fossile Abhängigkeit durch den Einsatz von CO₂-neutralen, speicherbaren Brennstoffen ersetzen.
Wie beeinflusst die Speicherkapazitätsbewirtschaftung der Wasserkraftwerke die Notwendigkeit fossiler Reservekraftwerke?
Die Bewirtschaftung der Speicherkapazitäten der Wasserkraftwerke spielt eine zentrale und entscheidende Rolle für die Versorgungssicherheit im Winter und beeinflusst direkt die Notwendigkeit und den Einsatz fossiler Reservekraftwerke.
Der kritischste Zeitpunkt für die Schweizer Stromversorgung ist der Spätwinter (etwa zwischen Anfang März und Ende April), insbesondere bei gleichzeitigem Ausfall von Atomkraftwerken und leer stehenden Speicherseen. In diesem Szenario fehlt es primär an Energie (TWh) und nicht an Leistung (GW), da die Speicherkraftwerke bei ausreichendem Wasserstand die benötigte Leistung liefern könnten.
Der Einfluss der Speicherkapazitätsbewirtschaftung:
1. Die Funktion der Wasserkraftreserve (Hydroreserve).
Um dem Mangel an Energie im Spätwinter vorzubeugen, besteht das Hauptziel darin, die Speicherkraftwerke während des Winterhalbjahres zu schonen.
Sicherung der Reserven:
Die Schonung der Stauseen führt nur dann zu einer erhöhten Versorgungssicherheit, wenn die zusätzlich im Winter erzeugte oder eingesparte Strommenge nicht frühzeitig am Markt verkauft wird, sondern tatsächlich zu grösseren Reserven in den Speicherseen führt.
Gesetzliche Verankerung:
Aus diesem Grund ist eine verbindliche Wasserkraftreserve in den Stauseen gesetzlich vorgeschrieben und muss überwacht werden. Diese Reserve, die seit 2025 im Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien verankert ist, sieht vor, dass Speicherkraftwerke gegen Entgelt eine bestimmte Menge Energie zurückbehalten, die im Bedarfsfall abgerufen werden kann.
Bewirtschaftung für Versorgungssicherheit:
Die Wasserkraftreserven müssen zukünftig konsequenter als "Pflichtlager Strom" bewirtschaftet werden, um auch extremen Wettersituationen bis Ende Februar standzuhalten, falls der Markt die Bewirtschaftung nicht automatisch an die Versorgungssicherheitsanforderungen anpasst.
2. Reduzierung der Notwendigkeit fossiler Kraftwerke.
Fossile Reservekraftwerke (z. B. Gaskraftwerke) sollen gemäss dem Konzept der ElCom primär dazu dienen, die Speicherkraftwerke zu schonen. Sie würden bereits mehrere Wochen vor einer absehbaren Strommangellage zum Einsatz kommen, um den Füllstand der Speicherseen hoch zu halten.
Jede Massnahme, die die Speicherseen schont, reduziert die Notwendigkeit fossiler Reservekraftwerke:
Alternative Lösungen:
Ein rascherer Ausbau der erneuerbaren Energien (insbesondere Photovoltaik und Windkraft), Energieeffizienzmassnahmen (wie die vom Bundesrat angestrebte Stromeinsparung von 10 % im Winter), oder erhöhte Stromimporte haben denselben Effekt auf die Schonung der Speicherseen wie der Einsatz fossiler Kraftwerke.
Bestmögliche Lösung:
Eine verbindliche Speicher-Wasserkraftreserve in Kombination mit einem raschen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion (mindestens so schnell wie im Mantelerlass Energie vorgesehen) und Effizienzmassnahmen wird als die beste Lösung für eine sichere Stromversorgung der Schweiz betrachtet.
Obsoleszenz fossiler Kraftwerke:
Wenn diese Massnahmen (Reservehaltung, Ausbau erneuerbarer Energien, Effizienz) konsequent umgesetzt werden, werden fossile Reservekraftwerke obsolet.
3. Schwäche des Reservekraftwerks-Konzepts.
Das Konzept, die Reserven durch fossile Kraftwerke zu schonen, weist eine inhärente Schwäche auf:
Mangelnde Vorhersehbarkeit:
Die fossilen Reservekraftwerke müssten Wochen vor dem eigentlichen Störfall (z. B. Ausfall von Atomkraftwerken) in Betrieb gesetzt werden. Da Ausfälle von Grosskraftwerken oft nicht vorhersehbar sind, könnten die fossilen Kraftwerke bei einem überraschenden Ausfall von AKW zu spät kommen, um eine Mangellage zu verhindern.
Vorteil Erneuerbare/Effizienz:
Im Gegensatz dazu entlasten Sparmassnahmen und der Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion im Winter die Speicherseen auf jeden Fall, da sie nicht erst bei drohenden Versorgungslücken aktiviert werden müssen.
Daher trägt eine auf Versorgungssicherheit optimierte Bewirtschaftung der Wasserkraftwerke – gestützt durch gesetzlich geregelte Reserven und flankiert von Effizienz und Ausbau erneuerbarer Energien – massgeblich dazu bei, dass der Bau und Betrieb teurer und klimaschädlicher fossiler Reservekraftwerke unnötig wird. Die geschätzten Kosten für fossile Reservekraftwerke (ca. 1,4 Milliarden Franken) könnten wesentlich zielführender in Energieeffizienz und erneuerbare Stromproduktion investiert werden.
Welche regulatorischen und finanziellen Anreize fördern den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz?
Die Förderung des schnellen Ausbaus erneuerbarer Energien in der Schweiz stützt sich auf eine Kombination aus weitreichenden regulatorischen Reformen und spezifischen finanziellen Anreizen, die hauptsächlich im Rahmen des neuen Stromgesetzes (Mantelerlass) verankert sind.
Die wichtigsten regulatorischen und finanziellen Instrumente zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien sind:
I. Regulatorische Rahmenbedingungen und Beschleunigung.
Der grundlegende regulatorische Rahmen wurde durch das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass), das am 9. Juni 2024 vom Volk angenommen wurde, geschaffen und trat gestaffelt am 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 in Kraft. Dieses Gesetz legt ambitionierte Ausbauziele für erneuerbare Energien (neben der Wasserkraft) bis 2050 auf 45 Terawattstunden (TWh) fest.
1. Beschleunigte Verfahren (Offensiven und Erlass):
Um den Bau neuer Anlagen zu beschleunigen und Hindernisse abzubauen, wurden spezifische Massnahmen eingeführt:
Solar-Offensive (Alpine PV-Grossanlagen):
- Zur raschen Stärkung der Winterversorgung wurde eine Solar-Offensive beschlossen:
- Die Bewilligungsvoraussetzungen werden vereinfacht.
- Die Anlagen gelten als von nationalem Interesse.
- Dadurch entfallen der Nachweis des Bedarfs (Bedarfsnachweis) und die Standortgebundenheit, und die Planungspflicht wird aufgehoben.
Wind-Offensive:
- Das Parlament beschloss im Juni 2023, die Bewilligungsverfahren für bereits fortgeschrittene Windenergieprojekte zu beschleunigen:
- Für eine begrenzte Anzahl weit fortgeschrittener Projekte von nationalem Interesse, die bereits einen rechtskräftigen, von der Gemeinde genehmigten Nutzungsplan besitzen, stellen neu die Kantone die Baubewilligung aus (statt der Gemeinden).
- Dieses beschleunigte Verfahren gilt, bis eine zusätzliche Leistung von 600 Megawatt installiert ist.
Beschleunigungserlass Netze:
Es ist vorgesehen, Verfahren für die Bewilligung von Projekten für erneuerbare Energien und den Netzausbau zu beschleunigen. Dazu gehören ein konzentriertes kantonales Plangenehmigungsverfahren für Wind- und Solarkraftwerke von nationalem Interesse.
2. Regulierung der Wasserkraft:
Runder Tisch Wasserkraft:
Im Dezember 2021 einigten sich Bund, Kantone, Strombranche und Umweltverbände auf 15 Wasserkraftprojekte (plus das Projekt Chlus), die im Stromgesetz explizit aufgeführt sind, um bis 2040 zusätzlich 2 TWh aus Speicherwasserkraft sicher abrufbar zu machen und so die kritische Winterversorgung zu stärken.
Wasserkraftreserve (Hydroreserve):
Eine verbindliche Reserve in den Stauseen wurde gesetzlich vorgeschrieben und überwacht, um sicherzustellen, dass zusätzlich erzeugter oder eingesparter Winterstrom nicht vorzeitig auf dem Markt verkauft wird, sondern zur Schonung der Speicherseen dient.
3. Förderung der Dezentralität und Flexibilität:
Mindestanteile inländischer erneuerbarer Produktion:
Grundversorger müssen neu Mindestanteile an inländischer erneuerbarer Energieproduktion für den Absatz in der Grundversorgung einhalten (Mindestens die Hälfte ihrer erweiterten Eigenproduktion muss in der Grundversorgung abgesetzt werden; ist dies nicht möglich, muss der restliche Absatz zu mindestens 20 % mit erneuerbarer Elektrizität aus Inlandanlagen gedeckt werden).
Virtuelle Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV) und lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG):
Das neue Recht ermöglicht virtuelle ZEV und LEG (Inkraftsetzung für LEG per 1. Januar 2026), um die Nutzung vorhandener Flächen (insbesondere Dach- und Fassaden-PV) und Speichermöglichkeiten zu verbessern, indem das lokale Verteilnetz für den Austausch von produziertem Strom genutzt werden darf.
Effizienzpflicht für Lieferanten:
Alle Elektrizitätslieferanten mit einem Referenzstromabsatz von 10 GWh oder mehr sind verpflichtet, Energieeffizienzmassnahmen bei Endverbrauchern zu ergreifen, mit steigenden jährlichen Zielvorgaben (1 % für 2026, 1,5 % für 2027 und 2 % ab 2028).
II. Finanzielle Anreize und Kostenüberwälzung.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Massnahmen zur Versorgungssicherheit werden primär durch den Netzzuschlag auf dem Netznutzungsentgelt finanziert.
1. Direkte Investitionsanreize:
Einmalvergütung (Solar-Offensive):
Für alpine PV-Grossanlagen wird eine spezielle Förderung in Form einer Einmalvergütung von bis zu 60 % der Investitionskosten festgesetzt.
Investitionsbeiträge für WKK-Anlagen:
Für neue Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK), die bestimmte Voraussetzungen erfüllen (wärmegeführt, hauptsächlich Winterbetrieb, Betrieb mit erneuerbaren Energieträgern, EHS-Teilnahme oder CO2-Kompensation), kann ein Investitionsbeitrag von maximal 60 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten in Anspruch genommen werden.
2. Anreize für Flexibilität und Effizienz:
Rückerstattung der CO2-Abgabe:
Betreiber von WKK-Anlagen, die nicht am Emissionshandelssystem teilnehmen, können die CO2-Abgabe auf fossilen Brennstoffen, die nachweislich für die Stromproduktion eingesetzt wurden, ganz oder teilweise zurückerstattet bekommen. Es werden 60 % der Abgabe auf den für die Stromerzeugung verwendeten fossilen Brennstoffen zurückerstattet, und weitere 40 %, wenn gleichwertige Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz ergriffen werden.
Reduzierte Netznutzungstarife für LEG:
Teilnehmer von Lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) erhalten einen Abschlag von 40 % auf den Netznutzungstarif (dieser Abschlag kann auf 20 % reduziert werden bei Transformationsbedarf).
Dynamische Netznutzungstarife:
Ab dem 1. Januar 2026 können dynamische Netznutzungstarife eingeführt werden, um Strombezüger mittels Tarifanreizen zu einem netzoptimierten Verhalten (Einklang von Produktion und Verbrauch durch intelligente Steuerungen) zu bewegen.
Anrechenbare Kosten für Effizienzmassnahmen:
Die Kosten, die Elektrizitätslieferanten für die Durchführung von Energieeffizienzmassnahmen ab 2025 entstehen und vom BFE akzeptiert werden, sind in den Tarifen anrechenbar.
3. Solidarisierung von Netzausbaukosten:
Die Kosten für Netzverstärkungen und neu auch für Anschlussverstärkungen (durch den Anschluss erneuerbarer Anlagen bedingt) werden stärker solidarisiert, d.h., sie können über das Übertragungsnetz auf alle Verbraucher überwälzt werden.
Dies umfasst pauschalisierte Abgeltungen für Netzverstärkungen auf der Niederspannungsebene und Kosten für die Verstärkung privater Erschliessungsleitungen (bei Anlagen > 50 kW) bis zu einem Höchstbetrag von 50 CHF/kW neu installierter Erzeugungsleistung. Ziel ist es, dass der Ausbau der Netzinfrastruktur nicht zum Engpass für neue Produktionsanlagen wird.
Der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Photovoltaik, wird auch als die beste Lösung für eine sichere Stromversorgung der Schweiz angesehen, die fossile Reservekraftwerke unnötig macht. Studien zeigen, dass der Ausbau der Erneuerbaren ökonomisch und ökologisch grosse Vorteile gegenüber dem Bau fossiler Reservekraftwerke bietet. Beispielsweise könnten die geschätzten Kosten für fossile Reservekraftwerke (ca. 1,4 Milliarden Franken) zielführender in den Ausbau der Energieeffizienz und der erneuerbaren Stromproduktion investiert werden. Es wird betont, dass ein massiver Ausbau der PV die Notwendigkeit von Stromimporten reduzieren und den verbrauchten Strom umwelt- und klimafreundlicher machen würde.
Fazit – sind Blog Reservekraftwerke überhaupt die richtige Lösung und vertretbar für die Schweiz?
Die Entscheidung des Bundesrates, angesichts der drohenden Strommangellage Reservekraftwerke (RKW) zu beschaffen und fünf neue Projekte (583 MW ab 2027) zu genehmigen, hat eine der schärfsten energiepolitischen Kontroversen der letzten Jahre ausgelöst.
Die Frage, ob diese Strategie vertretbar ist, hängt davon ab, ob man die Maxime der kurzfristigen Risikominimierung oder die langfristige Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit priorisiert.
Die Argumentation des Bundesrates: Unverzichtbare Versicherung.
Aus Sicht des Bundesrates und des UVEK sind die RKW eine notwendige Versicherung gegen extreme, nicht vorhersehbare Szenarien wie eine Gasmangellage, einen sehr kalten Winter oder unerwartete Revisionen von Kernkraftwerken. Sie dienen der kurzfristigen Stärkung der Energieversorgung in ausserordentlichen Knappheitssituationen.
Ihre Hauptfunktion ist es, die Wasserkraftreserve in den Speicherseen zu schonen. Da die grösste Bedrohung im Spätwinter auftritt, wenn die Seen leer sind, müssten die RKW bereits Wochen vor einem absehbaren Engpass in Betrieb genommen werden, um die Füllstände hoch zu halten. Die neuen 583 MW Kapazität erfüllen die Empfehlung der ElCom von mindestens 500 MW Reserveleistung ab 2030.
Die strategische Kritik: Teuer, unnötig und obsolet.
Kritiker aus Wissenschaft (ZHAW) und Umweltschutz (WWF) argumentieren vehement, dass die RKW-Strategie unnötig, teuer und ineffizient sei.
1. Strategische Überflüssigkeit:
Studien kommen zum Schluss, dass eine Kombination aus einer gesetzlich geregelten Wasserkraftreserve, einem raschen Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion (mindestens gemäss den Zielen des Mantelerlasses) und Energieeffizienzmassnahmen die "beste Lösung für eine sichere Stromversorgung der Schweiz" darstellt. Diese Alternativen würden die fossilen Reservekraftwerke obsolet machen.
2. Kosten und Effizienz:
Die Reservekraftwerke sind die "teuerste und unnötigste Variante". Die geschätzten Kosten (etwa 1,4 bis 1,88 Milliarden Franken für 1 GW in der ursprünglichen Planung) könnten "wesentlich zielführender" in erneuerbare Energie und Effizienz investiert werden. Die Kosten der RKW werden zudem über den Netznutzungstarif auf alle Stromverbraucher überwälzt.
3. Fehlendes Timing:
Da Ausfälle von Grosskraftwerken selten Wochen im Voraus vorhersehbar sind, könnten die fossilen RKW im Worst-Case-Szenario zu spät kommen, um eine Mangellage zu verhindern. Sparmassnahmen und der Ausbau erneuerbarer Energien im Winter hingegen "würden die Speicherseen auf jeden Fall entlasten".
4. Politischer und Juristischer Konflikt:
Der Bundesrat wird kritisiert, das Parlament, das Alternativen wie gepoolte Notstromaggregate und die Verbrauchsreserve als prioritäre Lösung ansieht, zu "torpedieren". Darüber hinaus stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die Betriebsbewilligung für das temporäre RKW Birr "nicht gesetzeskonform" war, da die Annahme einer schweren Mangellage im Winter 2022/23 nicht ausreichend belegt war.
Die CO₂-Neutralität als Kompromiss.
Ein wesentliches Element, das die neuen RKW ab 2027/2030 von den temporären, fossilen Anlagen unterscheidet, ist die Vorgabe, CO₂-neutrale Brennstoffe zu verwenden. Die Projekte in Eiken und Stein sollen mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben werden, während das Axpo-Projekt in Muttenz auf Biodiesel/HVO und später wasserstoffbasiertes E-Methanol setzt. Dies entschärft zwar die schärfste Klimakritik, doch bleiben die Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten und der strategischen Notwendigkeit bestehen.
Fazit.
Die Reservekraftwerke sind in erster Linie ein Ausdruck der Risikoaversion der Landesregierung, die in Anbetracht der globalen Energieunsicherheiten maximale Versorgungssicherheit als oberste Priorität ansieht.
Obwohl Alternativen wie der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien (PV, Wind) und Effizienzmassnahmen ökologisch und ökonomisch die bessere und langfristig sicherere Lösung darstellen, wurden die RKW aufgrund des politischen Willens zur schnellen Verfügbarkeit und zur Absicherung des Worst-Case-Szenarios beschlossen.
Die Reservekraftwerke sind eine sehr teure Notfallversicherung, die nur dann wirklich vertretbar wäre, wenn die überlegenen, klimaneutralen und kostengünstigeren Alternativen (Hydroreserve, NSA-Pooling, Effizienz und Zubau der Erneuerbaren) nicht schnell genug realisiert werden könnten. Ihr Bau wird von vielen Experten als unnötiger Vorgriff angesehen, der Steuergelder und Konsumentenpreise unnötig belastet, anstatt die bestätigten, zielführenden Alternativen zu forcieren.
Übersichtsseiten mit Inhaltsverzeichnissen.
Das Schweizer Stromnetz der Zukunft.
Alpine Solaranlagen im Bau und Ausbau.
Disclaimer / Abgrenzung
Stromzeit.ch übernimmt keine Garantie und Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Bericht enthaltenen Texte, Massangaben und Aussagen.
Quellenverzeichnis Stand Ende September 2025.
Die Quellen diskutieren primär die Strategien zur Sicherung der Schweizer Stromversorgung, insbesondere im Kontext des Atomausstiegs und der Klimaziele bis 2050. Ein zentrales Thema ist die Beschaffung und Rolle neuer Reservekraftwerke, wobei fünf Projekte mit einer Gesamtleistung von 583 Megawatt beschlossen wurden, die ab 2027 bis 2030 in Betrieb gehen und CO₂-neutral betrieben werden sollen. Parallel dazu wird intensiv die Alternative zum Bau fossiler Gaskraftwerke beleuchtet, indem Studien der ZHAW und Experten wie Jürg Rohrer betonen, dass ein rascher Ausbau erneuerbarer Energien (Photovoltaik und Windkraft) in Kombination mit einer gesetzlich regulierten Wasserkraftreserve die Versorgungssicherheit effektiver gewährleisten würde. Die Roadmap Grossen skizziert zudem einen Weg zu Netto-Null, bei dem Wasserkraft und Solarstrom das neue "Dreamteam" bilden, während die Notwendigkeit eines Stromabkommens mit der EU zur Gewährleistung von Winterimporten und die Potenziale von Speichertechnologien (Power-to-X, Batteriespeicher) hervorgehoben werden. Schliesslich werden in den Gesetzestexten und Expertenmeinungen regulatorische Massnahmen für die operative Abwicklung der Stromreserve, die Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (WKK) und die Förderung der Energieeffizienz detailliert.
Quellen.
https://www.news.admin.ch/de/newnsb/yNgfnQ6o9l7doYlqLOqF5
https://www.uvek.admin.ch/de/sichere-stromversorgung
https://www.strom.ch/de/perspective/stromgesetz-neue-regelungen-und-viele-umsetzungsfragen
https://www.strom.ch/de/perspective/stromgesetz-neue-regelungen-und-viele-umsetzungsfragen
https://42technology.ch/neues-und-aktuelles/
https://www.volker-quaschning.de/news/index.php
https://www.energieinside.ch/e-politik/strommangellage/fuenf-neue-reservekraftwerke
https://www.swisscleantech.ch/artikel/gaskraftwerke-als-notreserve-wichtig-oder-unnoetig/
https://energiestiftung.ch/erdgas-schweiz
https://energiestiftung.ch/studie/alternative-szenarien-zur-energiestrategie-2050
https://www.strom.ch/de/schwerpunkte/erneuerbare-energien-das-sind-die-ausbauprojekte
https://www.lu.ch/-/klu/ris/cdws/document?fileid=1d450b4cbea54bed93a0084589a58231
https://pubdb.bfe.admin.ch/de/publication/download/11160
https://www.ag.ch/de/themen/umwelt-natur/energie/energieversorgung-im-aargau/reservekraftwerk-birr
https://www.swissgrid.ch/de/home/newsroom/newsfeed/20230224-01.html
https://www.news.admin.ch/de/nsb?id=93959
PDF‘s
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2024/20240033/N1%20D.pdf
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2017-09/2014-Positionspapier-Gaskraftwerke.pdf
https://roadmap-grossen.ch/wp-content/uploads/2025/01/Roadmap-Grossen-Update-2025.pdf
https://www.birr.ch/public/upload/assets/2723/2023.02.10%20Faktenblatt%20Reservekraftwerk%20Birr%20-%20Stand%2010.%20Februar%202023.pdf?fp=1